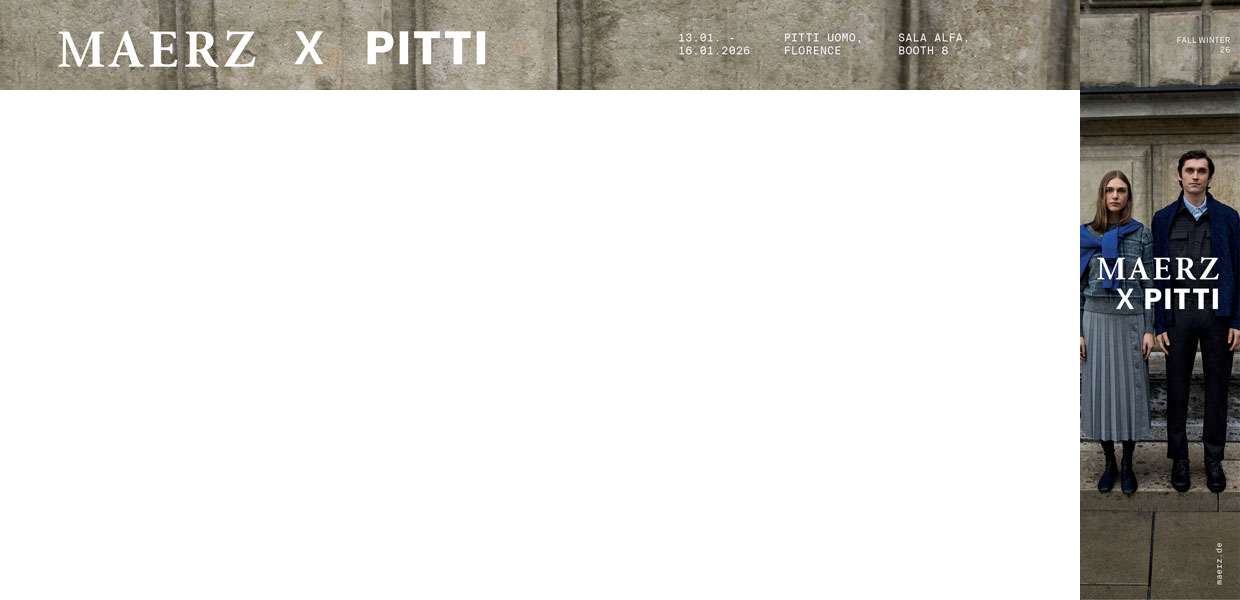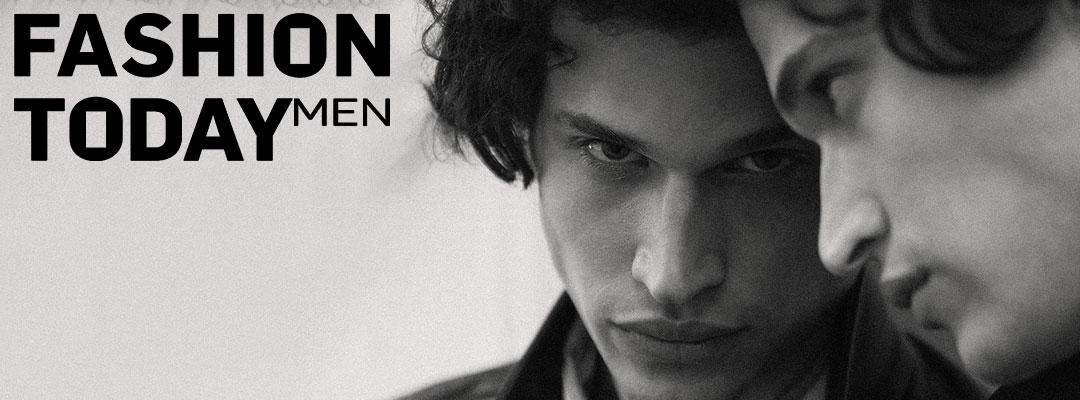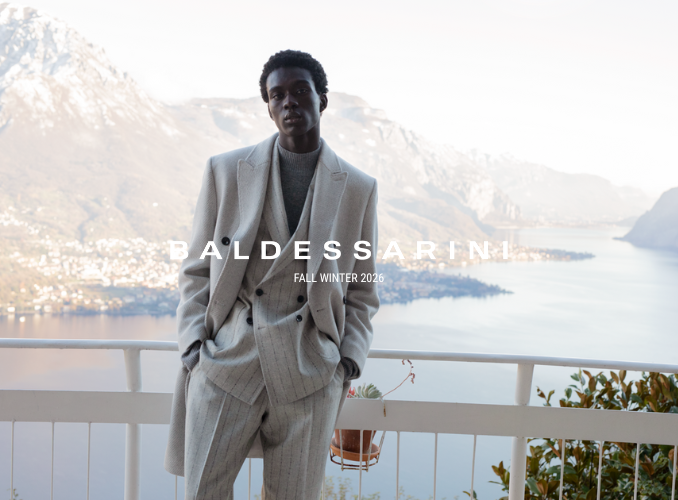Autor: Márton LiszkaDie Tage werden kürzer, die Luft wird kühler, das Licht zieht sich zurück. Wenn man in die Natur blickt, bekommt man das Gefühl, es würde sich alles verlangsamen in dieser Jahreszeit. Innendrin beschleunigen wir aber: Jahresabschluss, Termine, Erwartungshaltungen, die Auswirkungen des Sommerlochs noch zu stopfen. Ganz als ob wir noch schnell alles aufholen müssten, bevor ein weiteres Jahr zu Ende geht. Der 31. Dezember als Cut-off, alte Vorsätze schnell noch abhaken, damit die neuen am 1. Januar dann nicht gleich zum Scheitern verurteilt sind. Jährlich grüßt das Murmeltier, denn diese Dynamiken sind wirklich nichts Neues. Gleichzeitig spürt man jedes Jahr auch, wie stark der innere Wunsch ist, dieses Mal wirklich in Ruhe und Besinnlichkeit auf Weihnachten zuzusteuern. Sobald wir uns einmal ehrlich selbst betrachten, werden wir jedoch merken, wie schwer es uns fällt, Pausen zuzulassen, ohne sie zu rechtfertigen. In einer Zeit, die Schnelligkeit belohnt und das Verlangsamen misstrauisch sieht, muss man sich erst einmal trauen, wirklich komplett anzuhalten.
Unsere Gegenwart ist dicht. Nachrichten aus aller Welt und aller Art erreichen uns im Stundentakt, Konflikte verschieben Grenzen, Krisen überlagern einander. Wir können uns informieren und vernetzen wie nie zuvor, aber dieselben Kanäle, die uns verbinden, erschöpfen uns. Hinter jeder Überschrift wartet die nächste, hinter jeder Aufgabe eine weitere. Das erzeugt eine innere Unruhe, die weniger laut ist als ein Feueralarm, aber ebenso eindringlich. Sie treibt uns weiter, selbst wenn wir eigentlich stehen bleiben sollten. Pausen erscheinen vor diesem Hintergrund wie ein Luxus, den man sich erst leisten darf, wenn alles erledigt ist. Nur ist genau das die Illusion. Alles ist nie erledigt.
Ich bin inzwischen überzeugt, Pause ist mehr als eine Unterbrechung. Sie ist ein Zustand, in dem die Dinge, die uns beschäftigen, ihre wahre Größe und Bedeutung zurückbekommen können. Ohne diesen Raum verlieren wir die Fähigkeit zu unterscheiden, was wichtig ist und was nur dringlich wirkt. Um es musikalisch auszudrücken: Der Takt unseres Lebens braucht das Wechselspiel von Klang und Stille. So hat auch Claude Debussy gesagt: „Die Musik liegt nicht in den Noten, sondern in der Stille zwischen ihnen. “ Und so wird mir klar, wer das vergisst, bringt selbst das Schönste zum Dröhnen.
Das angeblich ideale Maß für Pausen lässt sich auch in einer Art Rhythmus gestalten: fünf Minuten jede Stunde, eine Stunde jeden Tag, ein ganzer Tag jede Woche, ein Wochenende jeden Monat, drei Wochen am Stück jedes Jahr und vielleicht sogar ein Jahr alle sieben Jahre. Als ich diesen Rat zum ersten Mal hörte, musste ich lachen. Inzwischen versuche ich, mich daran zu orientieren. Natürlich gelingt es nicht immer, aber schon die Idee hat etwas in mir verändert. Sie gibt den bewussten Pausen ein Gewicht, das über bloße Lücken im Kalender hinausgeht.
Pausen passen schlecht in diese Systeme, denn sie lassen sich nicht leicht messen und sie lassen sich schwer optimieren. Vielleicht haben sie auch deshalb ihren Ruf verloren.
Wenn ich auf unsere Welt blicke, sehe ich Kräfte, die diese „Stille zwischen den Noten“, diese Zwischenräume, verkleinern. Die wirtschaftliche Getriebenheit, die Erwartung dauernder Erreichbarkeit, Algorithmen, die uns an den Rand der Aufmerksamkeit drängen und dort festhalten. Pausen passen schlecht in diese Systeme, denn sie lassen sich nicht leicht messen und sie lassen sich schwer optimieren. Vielleicht haben sie auch deshalb ihren Ruf verloren. Wir lernen, effizient zu arbeiten, aber kaum jemand lehrt uns, gut zu pausieren. Dabei ist das gleichermaßen eine Kunst, die zu erlernen ist.
Die Kunst der Pause beginnt mit dem Erlauben. Viele von uns tragen die unterschwellige Idee in sich, dass nur produktive Minuten wertvoll sind – Stichwort „billable hours“. So fühlen wir uns schuldig, wenn wir langsamer werden, und kompensieren, indem wir die wenigen Pausen auch noch füllen. Wir scrollen, wir optimieren, wir verhandeln innerlich, wann es weitergehen darf. Doch eine gute Pause ist nicht Flucht und nicht Ablenkung. Sie ist eine freundliche Unterbrechung, in der wir uns sammeln. Für manche ist es Stille. Für andere Bewegung. Für wieder andere ein Gespräch oder ein Blick aus dem Fenster.
Ich habe mir lange eingeredet, dass ich Pausen dann mache, wenn sie sich ergeben. Sie ergeben sich aber meistens nicht. Erst als ich begonnen habe, sie zu setzen wie Beistriche, habe ich gemerkt, wie viel sich dadurch verschiebt. Witzigerweise habe ich mich mit Beistrichen in der Schulzeit auch schwergetan, aber das kann Zufall sein. Jedenfalls ist es erstaunlich, wie sich Gedanken ordnen, wenn man ihnen nicht die ganze Zeit im Weg steht. Manches, das eben noch groß und unaufschiebbar schien, schrumpft. Anderes, das leise war, tritt hervor. Die Pause selbst sortiert nicht, aber sie macht Platz, damit wir es können.
Eine weitere Erkenntnis für mich war, dass Pausen nicht nur privat sind. In komplexen Zeiten brauchen beispielsweise auch Organisationen Unterbrechungen, in denen nicht nur berichtet, sondern betrachtet wird. Teams, die diese Räume bewusst pflegen, sind nicht weniger leistungsfähig, sondern klarer. Sie treffen bessere Entscheidungen, weil sie zwischen Impuls und Reaktion einen kleinen, aber entscheidenden Spalt lassen. Dieser Spalt ist wiederum der Freiraum, in dem Verantwortung entsteht. Wer diesen streicht, ist zwar vielleicht schneller, aber am Ende nicht dort, wo er oder sie sein wollte.
Es gibt noch eine andere Seite der Pause, die mir wichtig geworden ist. Pausen müssen nicht einsam sein. Ich habe vor einiger Zeit gemerkt, dass mir Ruhe manchmal besser im Gespräch gelingt als im Rückzug. Aus diesem Gefühl ist mein Konzept des Inspiresso entstanden, ein Format für offene Gespräche bei einem Kaffee. Kein Meeting, keine Agenda, kein Ergebnisdruck. Nur Zeit und die Bereitschaft, Ideen und Gedanken miteinander zu teilen. Wir sprechen dort über das, was uns neugierig macht, über Ideen, die noch keinen Zweck haben, über Geschichten, die etwas in uns öffnen. Ich habe in diesen Inspiressi erlebt, wie eine gemeinsame Pause zu einem Resonanzraum wird. Man teilt eine Überlegung oder eine Beobachtung und plötzlich dehnt sich die Zeit. Nicht weil sie stehen bleibt, sondern weil sie an Tiefe gewinnt. So habe ich mit Menschen – egal wie gut oder wenig ich sie kannte – Themen und Gedanken besprochen, die sonst wahrscheinlich untergehen würden.
Selbstverständlich ist mir bewusst, dass Pausen ungleich verteilt sind. Manche Berufe lassen sie kaum zu, manche Lebenssituationen auch nicht. Deshalb meine ich mit Pause nicht ausschließlich lange Auszeiten. Ich meine Momente, die wir uns leisten können, auch wenn sie klein sind. Fünf Minuten Stille vor einem schwierigen Gespräch. Ein kurzer Spaziergang ohne Ziel. Drei tiefe Atemzüge am Fenster. Ein Abend, an dem nichts geplant ist. Die Kunst besteht darin, diese Momente nicht als Rest zu betrachten, sondern als Kernzeit. Mit dieser Um-Interpretation verändert sich der Kalender ins Positive, ohne dass er sich wirklich ändert.
Wenn ich an die großen Fragen unserer Zeit denke, an Kriege, Wetterextreme, politische Polarisierungen, technologische Sprünge, dann ist mir klar, dass sich das nicht mit ein paar Atemübungen auflösen lässt.
Es hilft, Rituale zu finden. Ein bestimmter Ort, eine wiederkehrende Uhrzeit, ein kleines Objekt, das erinnert. Für manche ist es die Tasse Tee in der Früh, für andere der leere Notizzettel oder ein kurzer aufbauender Satz auf dem Badezimmerspiegel. Ich kenne Menschen, die Pausen bewusst sichtbar machen, indem sie sie eintragen wie wichtige Termine. Das klingt banal, wirkt aber. Es ist eine Geste an sich selbst.
Wenn ich an die großen Fragen unserer Zeit denke, an Kriege, Wetterextreme, politische Polarisierungen, technologische Sprünge, dann ist mir klar, dass sich das nicht mit ein paar Atemübungen auflösen lässt. Aber ohne bewusst gesetzte Unterbrechungen verlieren wir die Fähigkeit, überhaupt angemessen zu reagieren – im kleinsten sowie aber auch im größten Rahmen.
Ich habe in meinen Inspiressi erlebt, dass aus einer Pause auch Handlungsimpulse entstehen, nicht trotz, sondern gerade wegen der Unterbrechung. Eine Idee, die vorher zu groß wirkte, wird in eine erste kleine Handlung übersetzt. Ein Projekt, das auf Autopilot lief, erhält eine Korrektur. Das ist die paradoxe Logik der Pause: Sie nimmt Tempo raus, um das Tempo dann richtig anpassen zu können.
Am Ende ist Pause keine Gegenbewegung zum Leben. Ohne sie wirkt alles gleich laut oder dröhnt sogar. Mit ihr kehrt Tiefe zurück. Mehr Momente, in denen Zeit wieder Zeit sein darf. Mehr Stillen, die nicht leer sind, sondern offen. Mehr Momente, in denen wir uns erlauben, nicht zu funktionieren, damit wir wieder wirklich handeln können.
Die verlorene Kunst der Pause ist nicht für immer verloren. Sie wartet genau dort, wo wir bereit sind, einen Schritt langsamer zu setzen. Wir können heute beginnen. Mit fünf Minuten. Mit einer Stunde. Mit einem Tag. Mit einem Gespräch. Mit einer Tasse Kaffee. Und vielleicht entdecken wir dann, dass in der Pause nicht weniger Leben liegt, sondern mehr.

Der Autor
Márton Liszka ist Gründer von Magali SOLUTIONS und begleitet Menschen und Organisationen dabei, Veränderung bewusst zu gestalten. Mit unterschiedlichen Formaten schafft er Räume für Klarheit, Selbstführung, Zusammenarbeit und Innovationskraft. Zuvor war er als COO beim Zukunftsinstitut tätig und bringt juristische Ausbildungen aus Österreich, Großbritannien und den Niederlanden mit. Sein zentrales Anliegen: Unsicherheit als Chance begreifen und nachhaltige Lösungen entwickeln, die Wirkung entfalten.
Mehr unter: www.magalisolutions.com