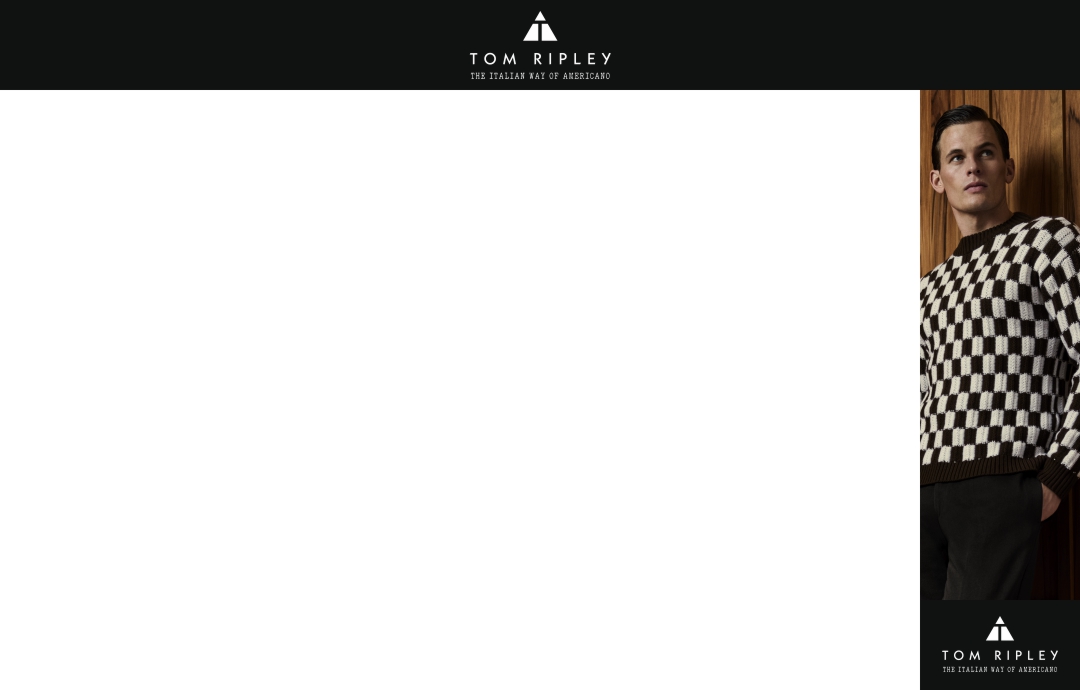Autorin: Yvonne Heinen Foudeh
Wir alle sind uns dessen bewusst – oder sollten es sein: Das Konzept „Fast Fashion“ hat seinen Zenit überschritten. Zumindest das, was aus einem ursprünglich gut gemeinten Geschäftsmodell gemacht wurde – aus schlichter Gier. Steht es doch in direktem Gegensatz zu allem, was unsere Branche jetzt angehen muss. Wohl verstanden – analog zur für die Branche überlebensnotwendigen Transformation wächst der Bedarf an Agilität. Die unternehmerische Fähigkeit, mit dem Fokus auf tatsächliche Marktanforderungen prompt zu (re)agieren, erweist sich als kritischer denn je zuvor.
Hier gilt es fein zu differenzieren – Botschaft angekommen arbeiten Management-Teams, Produktentwickler in Bekleidungskonzernen und SME-Fashion-Anbietern mit Volldampf an bedarfs-orientierten, gar on-demand-Lösungen – vielfach im Schulterschluss mit ihren jeweiligen Tech-Partnern für eine sinnvolle Umsetzung, basierend auf real-time-Daten.
Denn, der Weckruf an Modemacher und Modefreunde ist unüberhörbar: Textilverwerter in ganz Europa melden Alarm oder gleich Konkurs an, da sie die stetig zunehmenden Mengen von Bekleidungsabfällen schlicht nicht mehr wirtschaftlich stemmen können. Die Überproduktion von Fast Fashion hat verheerende Folgen für die Umwelt. Vor allem in afrikanischen Ländern verschwinden ganze Landstriche unter den riesigen Mengen an Altkleiderabfällen. Bilder dazu gehen um die Welt – wie stehen wir als verantwortliche Konsumgüter-Branche dazu?
Die neue EU-Abfallrahmenrichtlinie zeigt auf, wohin die Reise hier geht: Im Sinne einer Extended Producer Responsibility (EPR) werden – gemäß finaler Ratifizierung – Unternehmen aus Industrie und vertikal agierendem Handel für eine Kostenbeteiligung hinsichtlich Sammlung, Sortierungen und Recycling von Alttextilien in die Pflicht genommen [s. FT Ausgabe Mai 2025]
Fakt ist…
Die ehrgeizigen Ideen einer Kreislaufwirtschaft für Mode können jedenfalls keine gesamthafte Lösung für das Problem bieten – aufgrund der hohen Prozesskomplexität und der logistischen Herausforderungen. Infrarot-Analysen von Stichproben zeigen einen Kunstfaseranteil von 97 %. Darauf aufbauend ermittelten Studien im Auftrag des EU-Parlaments, dass jedes Jahr eine halbe Million Tonnen Mikroplastik in die Ozeane gelangen. Das bedeutet, 35 % des gesamten Eintrags bestehe aus Bekleidungsabfällen.
„Das Problem ist, dass 93 Prozent aller recycelten Textilien heute aus Plastikflaschen stammen, nicht aus Altkleidern“, erklärt Urska Trunk von der Kampagnengruppe Changing Markets. Und während eine PET-Flasche fünf oder sechs Mal recycelt werden kann – ein T-Shirt aus recyceltem Polyester kann nie wieder recycelt werden. Nach Angaben der gemeinnützigen Organisation Textile Exchange wird nahezu das gesamte recycelte Polyester aus PET (Poly-Ethylen-Terephthalat) hergestellt. Zumindest (und sicher nicht nur) in Europa werden die meisten Textilabfälle entweder deponiert oder verbrannt. „Nur 22 Prozent werden recycelt oder wiederverwendet – und das meiste davon wird zu Dämmstoffen, Matratzenfüllungen oder Reinigungstüchern verarbeitet“. Mit anderen Worten: Nur ein Prozent der zur Herstellung von Kleidung verwendeten Stoffe wird zu neuer Kleidung recycelt.
Unterdessen lässt allerdings der Wandel im Verbraucherverhalten auf sich warten – noch: Momentan steigen die Verkaufszahlen für Fast Fashion fröhlich weiter – weltweit und sowohl online als auch im stationären Handel.
Angesichts der oben genannten und enttäuschenden Erfahrungen der Endverbraucher mit Fast Fashion, die oft mit heißer Nadel genäht und mit aggressiven Preisen vermarktet wird, hat dies jedoch negative Auswirkungen auf das Bekleidungsgeschäft insgesamt: Fast Fashion degradiert alle Modeprodukte zunehmend zu Wegwerfartikeln. Damit läuft unsere gesamte Branche Gefahr, einen unermesslichen Schaden für ihren Ruf zu erleiden.
Noch gravierender ist allerdings der Schaden, den Ultra-Fast Fashion à la Shein und Temu verursacht. Beides – gezielte Verbraucheraufklärung und regulatorische Beschränkungen der Direktimporte, die tagtäglich unbemerkt auf die Märkte strömen – sind hier dringend notwendig, um den ökonomischen und ökologischen Schaden zumindest zu begrenzen. Immerhin gibt es überwiegend vertrauenswürdige Anzeichen dafür, dass das „De-Minimis-Schlupfloch“ für Pakete aus China, die unter einem bestimmten Wert ohne Inhaltskontrolle und zollfrei in die USA und erst recht in den EU-Markt gelangen, endlich geschlossen werden soll. Auch das Auskunftsersuchen der EU-Kommission in diesen Tagen an den Online-Marktplatz Shein hinsichtlich Einhaltung des Gesetzes über digitale Dienste und eine Reihe von Verbraucherrechten weist in die richtige Richtung (Details: s. FT, Mai 2025)
Und ja, wirtschaftlich erfolgreiche Fast Fashion-Marken wie Boohoos, Forever 21, The Gap, H&M oder Primark, sie alle präsentieren Konzepte, um die schädlichen Umwet-Auswirkungen auf verschiedene Weise etwas zu verringern. Untersuchungen unabhängiger Institutionen, die offenkundige Intransparenz von Marketing messages und auch eine Reihe skandalöser Enthüllungen wegen reinen Green washings zerstören jedoch jegliches das Vertrauen, bevor es je aufgebaut wurde.
Um nun die Eingangsfrage zu beantworten – kann Fast Fashion je nachhaltig sein? Die generelle Antwort kann, da wo wir aktuell stehen, nur ein klares, lautes, handlungsorientiertes NEIN sein. Dies gilt sowohl für die ökologische als auch für die ökonomische Argumentation – in einer Branche, in der wir zehn Teile herstellen, um drei zum vollen Preis, vier mit Preisnachlass und weitere drei gar nicht zu verkaufen, wie John Thorbeck in seiner Rolle als Hauptautor des „Under the Banyan Tree Report – Buyers and Suppliers in Fashion“ sorgfältig bewertet hat.
Der Preis der Untätigkeit
Und dennoch – profitable Geschäftspraktiken unter weitgehender Einhaltung aller ESG-Standards können Hand in Hand gehen – mit einem Konzept futuristischer Fast Fashion: Kein Geringerer als der Key Player im globalen Fast-Fashion-Einzelhandelsgeschäft, die spanische Inditex-Gruppe, lebt den Beweis dafür vor. – Vor allem durch die kontinuierliche Investition massiver Kapitalressourcen in eine systematische kurz- und langfristige Transformation hin zu Nachhaltigkeit über die Produktlieferkette hinweg: Kurzfristig betrachtet ist das meiste, was die Inditex-Gruppe finanziert und damit ermöglicht, sicherlich in erster Linie eine Form der Kompensation. Und das mit finanziellen Mitteln, die aus 50 Jahren Fast-Fashion-Geschäft stammen.
Ökologisch gut ist die Strategie der Spanier, aber eben obendrein ökonomisch klug. Die Warnungen zweier bedeutender Akteure der Finanzwelt in diesen Tagen belegen dies einmal mehr: Unisono verkünden die Boston Consulting Group und das Weltwirtschaftsforum, welchen erheblichen finanziellen Risiken Unternehmen ausgesetzt sind, die nicht jetzt Maßnahmen zur Dekarbonisierung ergreifen. Ferner quantifizieren BCG und WWF in Ihrem aktuellen gemeinsamen Bericht „The Cost of Inaction: A CEO Guide to Navigating Climate Risk” ihre Einschätzungen zu finanziellen Folgeschäden.
Und so nimmt der spanische Einzelhandelskonzern ohne Frage auch hier eine Vorbildrolle ein pro verantwortungsvollem und dabei wirtschaftlich erfolgreichem Modeunternehmertum.
FASHION TODAY stellt den Klassenbesten im Mode-Einzelhandel ausführlich vor: In unserer Titelgeschichte mit Part I im englischen Teil dieser Ausgabe und Teil II im Juli geht es deshalb auch um erfolgreiches Unternehmertum pro globaler Nachhaltigkeit, um Innovation in Textil & Bekleidung. Überzeugen Sie sich selbst und lassen sich inspirieren vom Phänomen Inditex mit „The Inditex Phenomena, Part I und Part II“.