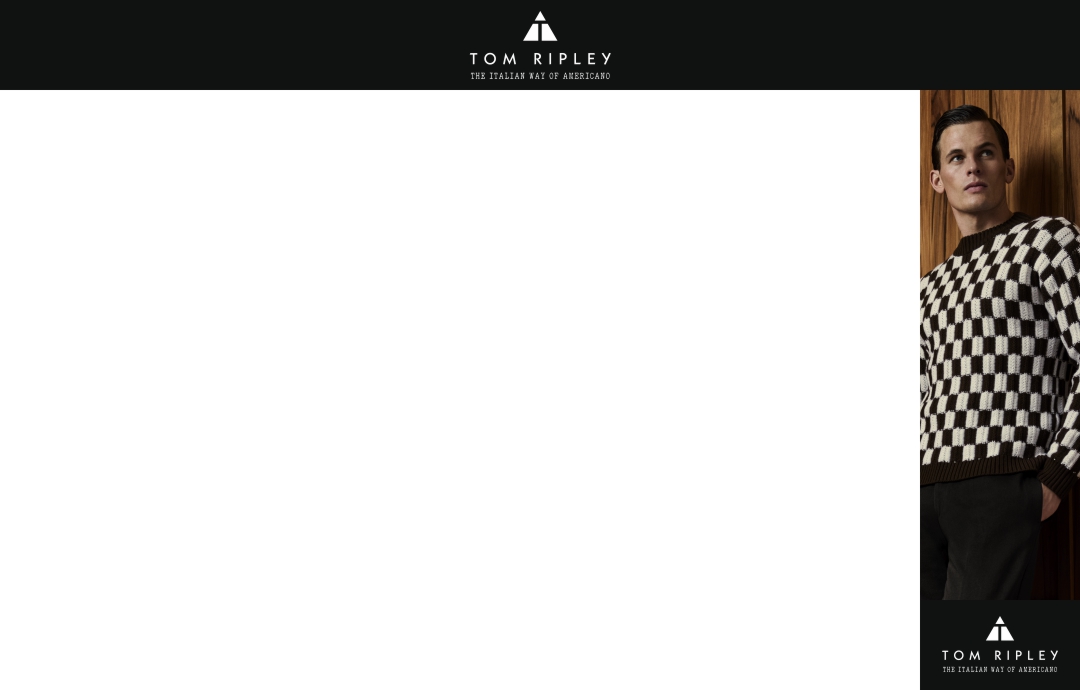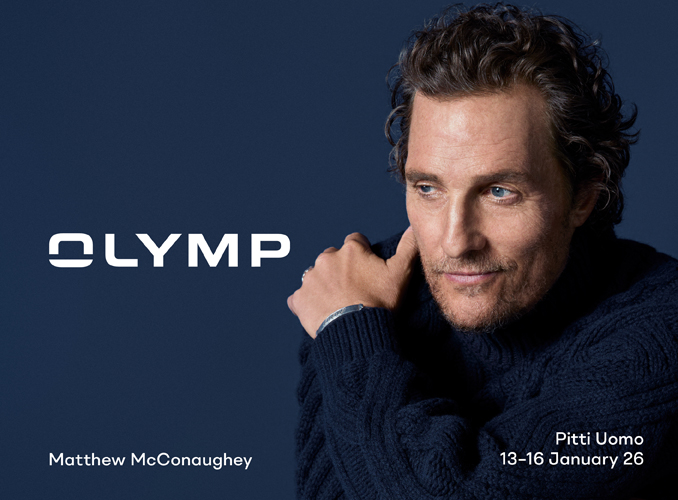Autor: Markus OessKrisen, Katastrophen, Kontrollverlust: In einer Zeit permanenter Verunsicherung braucht es neue Denkweisen und eine andere Haltung zur Zukunft. „Angst ist ein inneres Frühwarnsystem“, sagt Márton Liszka, Jurist und Zukunftsoptimist. Der Berater, Keynote Speaker und ehemalige COO des Zukunftsinstituts erklärt im FASHION-TODAY-Gespräch, warum Sicherheit kein Gegenteil von Mut ist, warum Asterix sein Superheld ist – und was Helden heute wirklich ausmacht. Das Interview kreist um individuelle Ängste und gesellschaftliche Narrative, um kulturelle Unterschiede im Umgang mit Unsicherheit – und um die zentrale Frage, wie wir als Gesellschaft handlungsfähig bleiben. „Mut entsteht oft erst da, wo man sich sicher genug fühlt, um ins Ungewisse zu gehen“, sagt Liszka.

FASHION TODAY: Wie wichtig ist Angst fürs Überleben?
Márton Liszka: „Sehr wichtig. Angst hat dem Menschen immer geholfen, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Und auch heute noch ist die Angst so etwas wie ein inneres Frühwarnsystem. Heute ist sie zwar oft subtiler – nicht mehr das zähnefletschende Raubtier vor uns, sondern komplexere Szenarien – aber die Funktion bleibt dieselbe: uns zu schützen und uns auf etwas hinzuweisen, das unsere Aufmerksamkeit braucht.“
Wie gefährlich ist sie fürs Überleben?
„Angst wird gefährlich, wenn sie uns dauerhaft blockiert oder von anderen gezielt geschürt wird. Wenn wir nicht mehr auf reale Gefahren reagieren, kann Angst lähmen und Gemeinschaften spalten. Es ist daher gefährlich, Angst zu viel Raum zu geben, dann verlieren wir unseren Handlungsspielraum – individuell wie gesellschaftlich.“
Wann werden individuelle Angstgefühle zu einem gesellschaftlichen Ereignis?
„Wenn viele Menschen zur gleichen Zeit ähnliche Unsicherheiten spüren und wenn diese Gefühle öffentlich geteilt und verstärkt werden, zum Beispiel durch Medien, politische Diskurse oder soziale Netzwerke. Dann wird diese jeweilige Angst zu einem kollektiven Narrativ, das wiederum verändert Entscheidungen und Verhalten auf breiter Ebene.“
Warum haben Menschen den Wunsch, Grenzen zu überschreiten, Neuland zu betreten, in dem Wissen, dass sie dabei sterben könnten?
„Weil wir nicht nur Überlebenswesen sind, sondern auch Sinnsucher. Neugier, Abenteuerlust, Gestaltungswille – all das treibt uns an. Für viele ist Grenzüberschreitung kein Trotz, sondern einfach eine Sehnsucht: nach Neuem, nach Tiefe, nach Bedeutung. Und ja, manchmal auch einfach nach dem Gefühl, wirklich zu leben.“
Wie sehr ist Sicherheit eigentlich eine emotionale Kategorie – und wie kann man diese rationalisieren, ohne zu banalisieren?
„Sicherheit ist vor allem ein Gefühl, ein sehr subjektives sogar. Objektive Daten helfen da nur begrenzt. Aber genau deshalb lohnt sich der Blick hinter das Sicherheitsbedürfnis – was steckt eigentlich dahinter? Kontrolle? Zugehörigkeit? Stabilität? Wenn wir das verstehen, können wir Sicherheit neu und intelligenter gestalten, ohne sie kleinzureden.“
Gibt es eine gesunde Balance zwischen Sicherheitsbedürfnis und dem Mut, der Menschen zu Abenteurern und Pionieren macht?
„Ja – aber die Balance ist sehr individuell. Manche Menschen brauchen erst ein stabiles Fundament, bevor sie losziehen. Andere brauchen das Risiko, um sich sicher zu fühlen. Hilfreich ist es, wenn Sicherheit nicht als Gegenspieler von Mut verstanden wird, sondern als Grundlage für Neues. Mut entsteht oft erst da, wo man sich sicher genug fühlt, um ins Ungewisse zu gehen.“
Inwiefern steht das Bedürfnis nach Sicherheit im Widerspruch zur Offenheit gegenüber Wandel, Migration und Globalisierung?
„Es kann ein Widerspruch sein, muss es aber nicht. Wer Sicherheit als Abschottung versteht, sieht Wandel als Bedrohung. Wer Sicherheit als Resilienz und Kooperation begreift, erkennt Wandel als Chance. Es braucht einfach ein neues Narrativ von ‚offener Sicherheit‘.“
Wie verändern neue Bedrohungsszenarien wie Klimawandel, KI oder geopolitische Krisen unseren Begriff von Sicherheit?
„Sie machen deutlich, dass klassisches Sicherheitsverständnis und Sicherheitslogiken an ihre Grenzen stoßen. Wir merken: Sicherheit hat heute viel mit Vernetzung, Systemverständnis und Zukunftsfähigkeit zu tun. Es geht weniger um Kontrolle, viel mehr um Anpassungsfähigkeit und reflektierte Voraussicht.“
Gibt es aus Ihrer Sicht kulturelle Unterschiede im Umgang mit Unsicherheit – etwa zwischen Europa, Asien und den USA?
„Soweit ich das beurteilen kann, ja. In Europa und vor allem im DACH-Raum erleben wir oft eine starke Orientierung an Planung und Ordnung, was ja auch viel Stabilität gebracht hat. In anderen Kulturen wird Unsicherheit eher als Teil des Lebens akzeptiert oder sogar als Chance gesehen – etwa nach dem Motto: ‚No risk, no reward‘. Beides hat aber seine Berechtigung.“
„Heute entstehen Grenzen oft durch digitale Dynamiken – durch Likes, Algorithmen, Shitstorms.“
Was denken Sie, überwiegt in Deutschland das Bedürfnis nach Sicherheit oder der Wunsch, Grenzen zu überschreiten?
„Historisch und strukturell eher das Sicherheitsbedürfnis. Aber ich sehe auch viele Menschen – gerade in jüngeren Generationen –, die neue Wege gehen wollen, mit Unsicherheit leben können und kreative Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind. Es ist ein Spannungsfeld und genau da entsteht oft etwas Neues.“
Wie kamen vor Social Media gesellschaftliche Grenzen zustande und wie werden heute Grenzen gesetzt – oder auch nicht?
„Früher lief das über Institutionen, Medien, Bildung. Heute entstehen Grenzen oft durch digitale Dynamiken – durch Likes, Algorithmen, Shitstorms. Manche Grenzen werden dadurch durchlässiger, andere verhärten sich. Die Debatten sind schneller, aber sicherlich nicht immer differenzierter.“
Wir empfinden die Welt und das globale Geschehen als disruptiv und ziemlich unsicher. Was macht das mit mir im Umgang mit meinem Gegenüber?
„Viele werden vorsichtiger und manchmal auch misstrauischer. Aber die Unsicherheit kann auch zu mehr Empathie führen. Es kann sehr helfen, wenn man merkt: Ich bin nicht allein mit meiner Unsicherheit. Ich sehe wirklich beides – Abschottung und neue Formen von Verbundenheit. Es hängt am Ende davon ab, wie wir unsere Beziehungen gestalten und ob wir Räume für echte Begegnung schaffen.“
Sind Menschen, die Grenzen überschreiten, heute immer noch Helden?
„Nicht automatisch. Wer heute Grenzen überschreitet, muss oft mit Gegenwind rechnen – wir leben in einer Zeit, in der vieles moralisch stark bewertet wird. Es geht nicht mehr nur um das große Wagnis, sondern auch um die Art, wie man es tut. Reflexion, Haltung, Empathie – das sind heute die Qualitäten, die eine inspirierende Figur ausmachen.“
Funktionieren in dem Sinne Ihrer Antwort Superhelden noch, können sie immer noch unsere Grundbedürfnisse bedienen?
„Sie funktionieren – aber anders. Wir sehnen uns nach Orientierung, nach Menschen, die Verantwortung übernehmen, ohne sich über andere zu stellen. Wir brauchen keine unverwundbaren Übermenschen und Alleskönner. Wir brauchen unperfekte Vorbilder, die zeigen, wie man in Unsicherheit navigiert.“
Wer ist Ihr Superheld?
„Jeder, der oder die mitten im Chaos Verantwortung übernimmt, ohne alle Antworten zu haben – nicht laut, nicht perfekt, aber mutig. Menschen, die zuhören können, andere mitnehmen und Neues wagen – trotz Unsicherheit. Ansonsten seit der Kindheit unverändert: Asterix.“

ZUR PERSON
Márton Liszka ist Jurist und Zukunftsoptimist. Nach juristischen Ausbildungen in Österreich, Großbritannien und den Niederlanden war er als COO beim Zukunftsinstitut tätig. Heute arbeitet er als Berater und Keynote Speaker mit den Schwerpunkten Strategie, Innovation und gesellschaftlicher Wandel. Sein Anliegen: Menschen und Organisationen zu ermutigen, Unsicherheit als Chance zu begreifen und Zukunft aktiv zu gestalten.