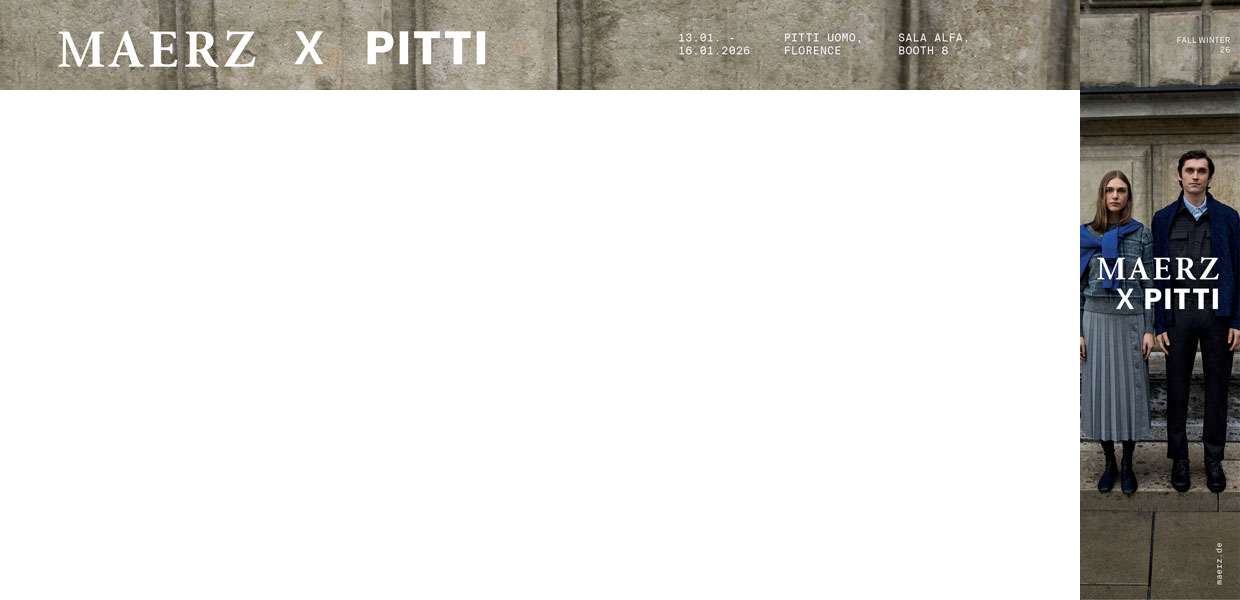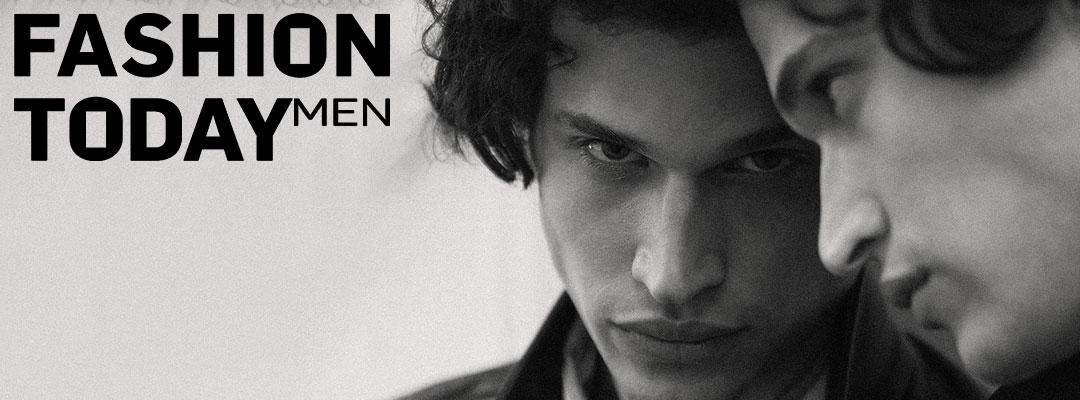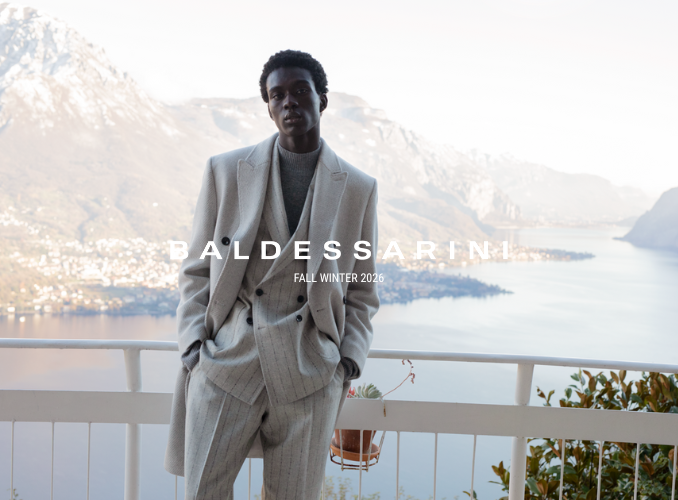Autorin: Eva Westhoff„Globale Lieferkettenrisiken sind kein neues Phänomen“, unterstreicht René Petri, Senior Vice President und Deutschlandchef der Einkaufsberatung Proxima. Doch verschiedene Faktoren und Ereignisse haben die „Verletzlichkeit globaler Wertschöpfung offengelegt“. Proxima, Teil der international agierenden Strategieberatung BAIN & COMPANY, hat in Zusammenarbeit mit OXFORD ECONOMICS eine Studie entwickelt, die eine umfassende Analyse globaler Beschaffungsrisiken liefert. Welche Orientierung bietet der „Global Sourcing Risk Index“ mit Blick auf eine ausgewogene Beschaffungsstrategie und welche Erkenntnisse ergeben sich für die Textilbranche? FASHION TODAY hat nachgefragt.
FASHION TODAY: Herr Petri, was bildet der „Global Sourcing Risk Index“ (GSRI) ab? Seit wann veröffentlicht Proxima diesen Index und für wen ist er interessant?
René Petri: „Der Global Sourcing Risk Index von Proxima wurde im Juni 2025 erstmals veröffentlicht. Der Index analysiert die 20 größten Volkswirtschaften weltweit, gemessen am BIP, sowie zehn aufstrebende und strategisch wichtige Märkte. Dabei werden zehn zentrale Beschaffungssektoren untersucht. Ziel ist es, aktuelle Risiken in der globalen Beschaffung sichtbar zu machen.
Bewertet wird anhand von acht Faktoren: geopolitische Konflikte, Klimarisiken, Compliance und Governance, Menschenrechte, Zollschranken und Handelsbarrieren, Volatilität bei Input- und Lohnkosten sowie Lieferantenkonzentration.
Adressaten sind vor allem Einkaufs- und Supply-Chain-Profis, die global einkaufen und resiliente wie kosteneffiziente Beschaffungsstrategien entwickeln müssen. Der Index zeigt auf Basis valider, international anerkannter Datenquellen das relative Risikoniveau in bestimmten Länder-Sektor-Kombinationen auf.“
Welche Hauptfaktoren beeinflussen die aktuellen Risiken? Haben sich diese in den letzten Jahren verändert?
„Globale Lieferkettenrisiken sind kein neues Phänomen, sie sind über Jahrzehnte hinweg schleichend im internationalen Handel gewachsen. Liefernetzwerke sind heutzutage weit verzweigt, mehrstufig und hochkomplex. Doch erst Ereignisse wie die Corona-Pandemie, geopolitische Spannungen, Handelskonflikte, der Klimawandel und die anhaltende Inflation haben diese Risiken in den Fokus gerückt und die Verletzlichkeit globaler Wertschöpfung offengelegt.
Es geht also weniger darum, ob sich die Risiken verändert haben, sondern wie stark das makroökonomische Umfeld sie verschärft hat. Risiken sind heute deutlich sichtbarer, ebenso wie die Folgen, wenn sie nicht aktiv gemanagt werden: Ausfälle, Unterbrechungen, Kontrollverlust. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, die eigene Anfälligkeit zu verringern und agile Strukturen aufzubauen.“
Wie die Proxima-Studie offenlegt, richten viele Unternehmen ihre globalen Beschaffungsstrukturen derzeit neu aus. Gibt es Trends?
„Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen mit China, unsicherer Handelsbeziehungen und steigender Kosten beobachten wir eine wachsende Tendenz zur Entkopplung von China – sowohl bei US-amerikanischen als auch bei internationalen Unternehmen. Allerdings vollzieht sich dieser Wandel nicht in Form eines vollständigen Rückzugs, sondern vielmehr durch eine gezielte Diversifizierung der Lieferantenbasis: Statt ausschließlich auf China zu setzen, ergänzen viele Unternehmen ihre Beschaffungsstrategien durch Nearshoring in Lateinamerika oder Südostasien oder durch sogenanntes Friendshoring in politisch verbündeten Staaten.
Es geht darum, die richtige Balance im Spannungsfeld zwischen Risiko und Kosten zu finden. Häufig sind es gerade die risikoreichsten Märkte, die besonders günstige Konditionen bieten. Doch immer mehr Unternehmen setzen auf eine ausgewogenere Beschaffungsstrategie und kombinieren kostengünstige mit stabileren, wenn auch teureren Standorten, etwa in etablierten europäischen Märkten. Das zeigt deutlich: Beschaffung im Jahr 2025 orientiert sich längst nicht mehr nur am besten Preis.“
Welche Rolle spielt die fortschreitende geopolitische Entkopplung zwischen den USA und China bei dieser Neuausrichtung?
„Die Entkopplung zwischen den USA und China beeinflusst längst nicht nur diese beiden Länder: Sie wirkt sich auf das gesamte globale Handelsgefüge aus. Ein zentrales Thema ist hier das sogenannte ‚Rules of Origin‘-Prinzip: Selbst wenn die Produktion beispielsweise formal in Vietnam stattfindet, können weiterhin chinesische Zölle gelten, wenn ein Großteil der Vorprodukte aus China stammt.
Das bedeutet: Unternehmen müssen tiefgreifende strukturelle Veränderungen in ihrer Lieferkette vornehmen – von der Rohstoffbeschaffung über die Verarbeitung und Produktion bis hin zur Distribution. Oberflächliche Optimierungen reichen nicht aus.“
Länder wie Mexiko, die Türkei und Indien sind dem jüngsten GSRI zufolge einerseits neue Beschaffungszentren, andererseits Hochrisikostandorte. Welche Empfehlungen lassen sich aus diesem Ergebnis ableiten, insbesondere für Unternehmen der Textilbranche?
„Diese Länder bieten zwar attraktive Vorteile – niedrige Kosten, strategische Lage –, aber bringen auch spezifische Risiken mit, etwa in den Bereichen Compliance und Governance, Menschenrechte und Klimarisiken. Gerade für die Textilbranche, die extrem anfällig für Störungen ist, ist dieser Balanceakt herausfordernd und erfordert einen resilienten und ausgewogenen Beschaffungsansatz.
Der Schlüssel liegt in der Diversifizierung. Unternehmen sollten Risiken nicht komplett vermeiden wollen, sondern gezielt steuern. Länder wie Mexiko, die Türkei oder Indien werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil textiler Lieferketten sein, sollten diese aber nicht vollständig dominieren. Entscheidend ist, das eigene Produktspektrum zu analysieren und darauf aufbauend die geeignete Beschaffungsstrategie zu entwickeln.
Zudem ist die Textilindustrie durch ihre mehrstufigen Lieferketten besonders komplex. Unternehmen sollten daher ihre Sorgfaltspflichten und Compliance-Prüfungen deutlich intensivieren, über Zertifikate hinaus. Dazu gehören Vor-Ort-Audits, der Aufbau lokaler Partnerschaften zur Sicherstellung von Standards sowie agile Vertragsgestaltungen mit Ausweichklauseln und alternativen Lieferwegen, um im Störungsfall schnell reagieren zu können.
Wichtig ist auch: Risiko ist per se nichts Schlechtes. Wer Risiken frühzeitig erkennt, bewertet und aktiv managt, kann daraus klare Wettbewerbsvorteile ziehen – etwa durch Kostenvorteile oder spezialisierte Kompetenzen – und zugleich die Versorgungssicherheit stärken.“
Welche weiteren zentralen Erkenntnisse aus dem Report erachten Sie als für die Textilbranche relevant?
„Die Studie identifiziert drei wesentliche Risikofaktoren, die für die Textilbranche von besonderer Bedeutung sind: Klima, Lieferantenkonzentration und regionale Dynamiken.
Klimarisiken: Viele Beschaffungsregionen der Branche befinden sich in Süd- oder Südostasien, etwa in Indien oder Vietnam. Diese Regionen sind bereits heute stark von Extremwetterereignissen und klimabedingten Naturkatastrophen betroffen, Tendenz steigend. Der Klimawandel bedroht zunehmend nicht nur die Produktionsfähigkeit, sondern ganze Geschäftsmodelle.
Lieferantenkonzentration: Die Textilbranche stützt sich weltweit auf eine recht überschaubare Anzahl von Lieferanten und Ländern, darunter Indien, die Türkei, Vietnam oder auch China. Bei Störungen hat das massive Kettenreaktionen zur Folge.
Regionale Dynamiken: Der Report zeigt ein Spannungsfeld zwischen Südostasien und Europa auf: Während Südostasien mit wettbewerbsfähigen Kosten punktet, sind die Risiken dort deutlich höher. Europa bietet zwar mehr Stabilität, dafür aber auch höhere Inputkosten. Erfolgreiche Beschaffungsstrategien müssen diese Gegensätze gezielt austarieren.“
Europa gilt laut GSRI als sicherste Region für die Beschaffung, weist jedoch gleichzeitig das höchste Risiko bei den Inputkosten auf. Gibt es Strategien, die hier das Risiko mindern können?
„Ja, es gibt eine Reihe wirkungsvoller Strategien, um das hohe Kostenrisiko in Europa abzufedern und den Standort langfristig wettbewerbsfähig zu halten. Einkaufsverantwortliche sollten ihre gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen und gezielt Potenziale zur Effizienzsteigerung identifizieren, zum Beispiel durch den Einsatz von Automatisierungstechnologien und KI, um Prozesse zu verschlanken, Produktivität zu steigern und Lohnkostenerhöhungen zu kompensieren.“
Durch ESG-Anforderungen (Environmental, Social, Governance) und regulatorische Vorgaben wie die Europäische Lieferkettenrichtlinie, die 2028 in Kraft treten soll, könnte der Aufwand für Unternehmen, ihre Supply Chain zu dokumentieren beziehungsweise anzupassen, weiter steigen. Führt dies zwangsläufig zu Wettbewerbsnachteilen? Proxima entwirft ein Risikomodell mit Transparenz im Mittelpunkt.
„Auf den ersten Blick vielleicht, denn Compliance erhöht den administrativen und operativen Aufwand. Doch aus Sicht von Proxima ist Transparenz kein bloßes Compliance-Thema, sondern ein zentraler Baustein für resiliente Lieferketten. Wer Risiken – etwa im Bereich Arbeitsrechte oder Governance – proaktiv aufdeckt, kann sie besser managen.
CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)-konforme Lieferketten bieten Unternehmen einen tieferen Einblick in ihre Wertschöpfung, stärken ihre Position gegenüber Investoren und Konsumenten und werden so zu einem echten Wettbewerbsvorteil.“
Welche Rolle spielen Digitalisierung oder KI bei der Risikominderung im globalen Sourcing?
„Kurz gesagt: Digitalisierung und künstliche Intelligenz haben das Potenzial, das Risikomanagement in der Beschaffung grundlegend zu verändern. Dazu gehören unter anderem eine deutlich verbesserte Transparenz in der Supply Chain sowie die Fähigkeit, komplexe, mehrstufige Liefernetzwerke präzise abzubilden. Mithilfe prädiktiver Analytik lassen sich potenzielle Störungen, beispielsweise durch Wetterereignisse, geopolitische Instabilität oder volatile Kostenentwicklungen, frühzeitig erkennen.
Auch Compliance-Prozesse können zunehmend automatisiert werden. Digitale Zwillinge ermöglichen es zudem, Szenarien realitätsnah zu simulieren, bevor sie in der Praxis umgesetzt oder skaliert werden. Die Einsatzmöglichkeiten von KI und digitalen Tools entwickeln sich stetig weiter und bieten enormes Potenzial, um Beschaffungsentscheidungen zukunftssicher zu gestalten.“
Wie sieht Proxima die zukünftige Entwicklung des „Global Sourcing Risk Index“? Erwarten Sie größere Veränderungen oder Stabilität?
„Wir gehen davon aus, dass sich der Global Sourcing Risk Index (GSRI) dynamisch weiterentwickeln wird, eine Phase der Stabilität ist aktuell nicht absehbar. Zwar mögen sich einzelne Märkte zeitweise beruhigen, doch das globale Umfeld bleibt volatil und unterliegt ständigen Veränderungen auf makro- und mikroökonomischer Ebene.
Wir rechnen damit, dass neue Risikofelder wie Cyberangriffe oder geopolitische Fragmentierung künftig eigene Bewertungsmaßstäbe erfordern. Gleichzeitig werden sich branchenspezifische Erkenntnisse weiter vertiefen, neue Lösungsansätze entstehen und die Integration digitaler Tools wird das Risikomanagement in der Beschaffung deutlich intelligenter und datenbasierter machen.
Eines ist sicher: Risikobewertung ist fester Bestandteil jeder Beschaffungsentscheidung – und wird es auch langfristig bleiben.“
Info:
Proxima wurde 1994 in London gegründet. 2022 erfolgte die Übernahme der britischen Einkaufsberatung durch das international agierende Consulting-Haus BAIN & COMPANY. 2025 expandierte die BAIN-Tochter und eröffnete in Düsseldorf die erste Niederlassung in Deutschland. Sie ergänzt Proxima-Standorte in Großbritannien und den USA. BAIN & COMPANY unterhält Büros in 67 Städten und 40 Ländern. Deutschland-Hauptsitz ist München.