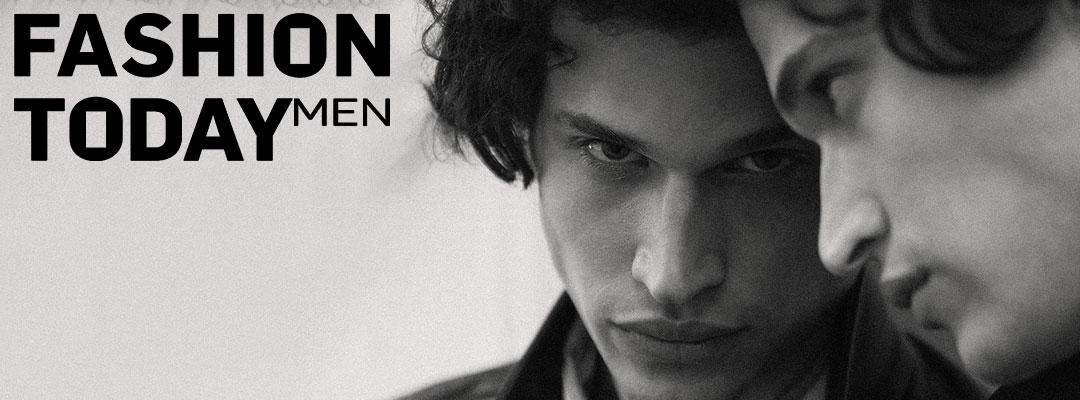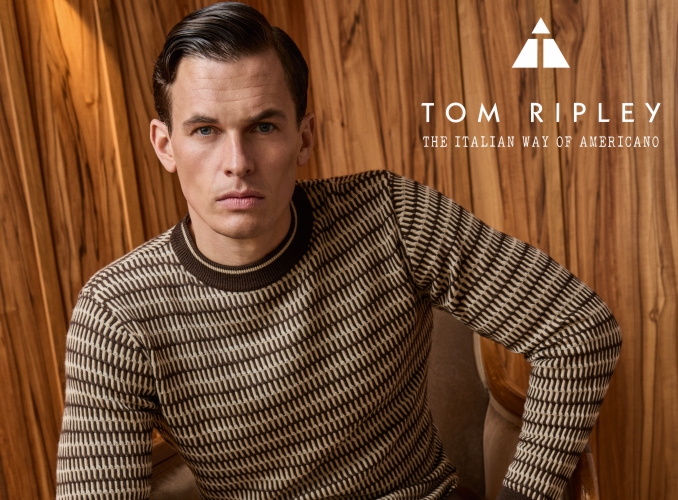Autorin: Katja VadersIn den 1980er-Jahren erkannte man viele Rechtsextreme an ihrem martialischen Äußeren als Skinheads: Glatze, Bomberjacke, Dr. Martens mit Stahlkappen und enge Jeans. Sie trugen bevorzugt Marken wie LONSDALE, Ben Sherman oder Fred Perry und traten vor allem laut und aggressiv auf. Inzwischen hat sich das äußere Erscheinungsbild der Szene gewandelt: Die neue Rechte zeigt sich gerne in teurer Outdoor Wear, aber auch in Chinos und Anzug; man bemüht sich, über den durchaus fashionablen Look der sogenannten „Nipsters“ den des aggressiven Skinheads abzulösen. Teil der Szene sind aber auch „Autonome Nationalisten“, deren Dresscode dem des Schwarzen Blocks der extremen Linken zum Verwechseln ähnlich sieht. Über diese Entwicklung, die bevorzugten Styles und Marken von rechten, aber auch linken Extremisten, sprach FASHION TODAY mit Felix Neumann, Referent für Extremismus- und Terrorismusbekämpfung der Konrad-Adenauer-Stiftung.

FASHION TODAY: Herr Neumann, Sie sind Referent für Extremismus- und Terrorismusbekämpfung. Wie sieht konkret Ihre Arbeit aus?
Felix Neumann: „Ich beschäftige mich mit allen verfassungsfeindlichen, extremistischen, gewaltbereiten Bestrebungen, die wir mit lokalen Schwerpunkten innerhalb Deutschlands, aber auch europaweit sehen. Abhängig davon, wie sich die Tendenzen entwickeln, kann das mal mehr mit Rechtsextremismus, Islamismus oder auch mit Linksextremismus sein. Hin und wieder kommen aber auch Nischenthemen auf.“
Was sind in diesem Zusammenhang Nischenthemen?
„Anfang des Jahres habe ich eine kleine Publikation zur Incel-Community herausgebracht („Incel“ ist die Eigenbezeichnung einer in den USA entstandenen Internet-Subkultur heterosexueller Männer, die unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr beziehungsweise Beziehungen zu Frauen hat und die unter anderem Misogynie verbreitet, Anm. der Autorin). Durch die Netflix-Serie ,Adolescence‘ ist das Thema allgemein bekannter geworden und wir wollten die Möglichkeit bieten, sich noch ein bisschen tiefer über die Incel-Thematik informieren zu können. In unserem kleinen Handbuch diskutieren wir, was hinter der Community steckt, wie man das Phänomen einordnen kann und wie gefährlich es ist.“
Beobachtungen legen nahe, dass die Incel-Community sich längst mit anderen Szenen verknüpft hat; wie der Attentäter von Halle, ein Rechtsextremer, der sich auch der Incel-Szene zugehörig fühlte.
„Dafür gibt es unterschiedliche Begriffe, manche nennen das Salatbar-Ideologie: Ich mag Gurken, Tomaten, aber keine Oliven, dazu suche ich mir ein bestimmtes Dressing aus, auf Zwiebeln habe ich heute keine Lust … Eine ähnliche Vorgehensweise sehen wir beim Extremismus. Es ist schwieriger geworden zu kategorisieren. Der Attentäter von Halle war ganz klar antisemitisch, rechtsextrem, ausländerfeindlich, aber eben auch Teil der Incel-Community. Das ist eine Vermischung von Ideologien, die schwer erkennen lässt, welche Motivation bei dem Anschlag prägend war. Und das macht es für Analystinnen und Analysten wie mich, aber natürlich vor allem für die Sicherheitsbehörden schwierig, Täter einzuordnen.“
Eine ähnliche Entwicklung kann man bei der Kleidung beobachten. In den 1980er- oder 1990er-Jahren waren Extremisten ganz klar erkennbar: Viele Rechte kleideten sich als Skinheads, Protagonistinnen und Protagonisten der linken Szene waren oft als Punks unterwegs. So einfach ist das längst nicht mehr. Sie beschäftigen sich daher unter anderem mit den Dresscodes von Extremisten und Extremistinnen. Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen?
„Die Erkennungsmerkmale dieser Szenen, also wie sie sich nach außen repräsentieren, ist in allen Extremismusformen sehr entscheidend. Bleiben wir beim Thema Rechtsextremismus: Hier spielt das Äußere eine ausschlaggebende Rolle, um eine gewisse Zugehörigkeit zu schaffen, intern, aber auch nach außen. Sie haben die rechtsextremen Kleidungsäußerungen, also die Dresscodes der 1980er- und 1990er-Jahre, schon sehr klar beschrieben. Seinerzeit konnte man anhand der Kleidung relativ einfach transportieren, dass man dazugehört.“
Nur der Vollständigkeit halber: Bereits früher trugen die Führungspersönlichkeiten und Vordenker der rechten Szene eher Anzüge, inzwischen haben wir mit der AfD eine zumindest in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei im Bundestag sitzen, deren männliche Repräsentanten tendenziell ebenfalls Schlips und Kragen tragen. Aber welcher Kleidungsstil und vor allem welche Marken werden in der Szene bevorzugt?
„Es gibt grundsätzlich Marken, die ganz tief in der rechtsextremistischen Szene verankert sind. Dazu gehört vor allem THOR STEINAR, das wohl klassischste Label der Rechtsextremen, das seit Jahren riesengroße Umsätze erzielt. Wir sehen aber auch, dass in der Szene im Zusammenhang mit Musikfestivals oder Kampfsport-Events für entsprechende Veranstaltungen oder einen gewissen Zeitraum T-Shirts und Hoodies bedruckt und verkauft werden, mit denen ebenfalls viel Umsatz gemacht wird. Hinter solcher Bekleidung stecken keine großen Marken, sondern beispielsweise Bands, die über diese Shirts sich selbst, aber auch ihre Ideologie vermarkten möchten.
Bei anderen in der Szene bevorzugten Marken wird es deutlich schwieriger, deren Trägerinnen und Träger in eine Kategorie einzuordnen, weil sie keinen entsprechenden Hintergrund haben, sondern von den rechtsextremistischen Akteurinnen und Akteuren instrumentalisiert werden. Die bekanntesten Brands in diesem Zusammenhang sind sicherlich LONSDALE und Fred Perry, deren Unternehmensführungen sich aber ganz klar gegen Rechtsextremismus positionieren.“
„Wenn ich mir Videos von rechtsextremen Demonstrationen anschaue, habe ich bezogen auf das Äußere manchmal das Gefühl, der linksextreme Schwarze Block laufe mit.“
Gibt es auch Marken, die in der linksextremen Szene bevorzugt werden?
„Das lässt sich deutlich schwieriger bestimmen, weil wir es hier mit einer gewissen Diversität zu tun haben, für die die linksextreme Szene bekannt ist. Bei Mitgliedern des sogenannten Schwarzen Blocks sehen wir allerdings sehr häufig schwarze Jacken von THE NORTH FACE. Auch hier würde ich von einer Instrumentalisierung der Marke sprechen, die keine Rückschlüsse auf das Unternehmen zulässt. Die Beliebtheit dieser Marke in der Szene liegt wohl eher daran, dass man mit deren schwarzen Jacken ein Einheitsgefühl schaffen kann, das auch sichtbar wird.“
Auf linken Demonstrationen werden insgesamt häufig Outdoor-Marken getragen, wie gesagt vor allem THE NORTH FACE, beliebt in der Szene sind aber auch die Bekleidung und Accessoires von patagonia. Die Marke ist eher im höherpreisigen Segment angesiedelt. Steht deren Beliebtheit nicht konträr zur antikapitalistischen Haltung der linksextremen Szene?
„Ich bin mir unsicher, wie patagonia sich als Marke konkret aufstellt, aber intuitiv würde ich sagen, es ist eine Marke, die sich für Umwelt- und Naturschutz einsetzt und sehr nachhaltig geprägt ist – ein Narrativ, das in der linksextremistischen Szene als sehr wichtig anerkannt werden muss. So könnte man vielleicht erklären, wie diese Verbindung zustande kommt.“
Lassen Sie uns auf die rechte Szene zurückkommen. Auf Ihrer Website findet sich ein sehr interessanter Artikel zum Thema Dresscodes von Extremistinnen und Extremisten, in dem das Äußere von Rechtsextremen idealtypisch in drei Gruppierungen eingeteilt wird: die Scheitel, ein Begriff, der auf den Kleidungsstil von Adolf Hitler verweist, die Glatzen, also Skinheads, und die Autonomen Nationalisten, die sich im Erscheinungsbild wenig von Mitgliedern der linken Szene unterscheiden.
„Der Text ist nicht aktuell, sondern aus dem Jahr 2015, daher würde ich zu diesen drei Kategorien noch eine weitere Gruppierung ergänzen. Inzwischen hat es nämlich eine sehr spannende Entwicklung gegeben. Sie haben vielleicht schon einmal vom Begriff ,Nipster‘ gehört, der sich aus ,Nazi‘ und ,Hipster‘ zusammensetzt und der vor circa zehn Jahren durch die Identitäre Bewegung, eine rechtsextremistische Organisation aus Österreich, sehr stark gepusht wurde. Wir haben es hier mit einem klaren Wandel des Kleidungsstils der extremen Rechten zu tun, weg von Scheitel und Glanze, hin zu längeren Bärten, Karo-Hemden, Jeans und Sneakern. Man möchte also ganz klar das Aussehen verändern, um freundlicher und weniger abschreckend zu wirken als mit Scheitel oder Glatze. Um auf die Autonomen Nationalisten zu kommen: Wenn ich mir Videos von rechtsextremen Demonstrationen anschaue, habe ich bezogen auf das Äußere manchmal das Gefühl, der linksextreme Schwarze Block laufe mit.“
Wie kommt es, dass die Rechten sich so stark an das Erscheinungsbild von Teilen der linksextremen Szene angepasst haben?
„Hier gab es offenbar gewisse Learnings auf beiden Seiten, man beobachtet sich gegenseitig. Denn wenn man sich die Aufmärsche vom Schwarzen Block anschaut, erkennt man, welche Wirkung diese Auftritte haben: Alle sind schwarz gekleidet, teilweise vermummt. Daran hat sich die rechtsextreme Szene orientiert und das Aussehen kopiert – obwohl man der Linken eigentlich feindlich gegenübersteht. Auch bei der Rechten sieht man übrigens Bekleidung von THE NORTH FACE, die Marke wird also offensichtlich von beiden Seiten adaptiert.
Ähnliche Adaptionen konnte man übrigens bei der Klimabewegung beobachten, deren Narrativ mit dem Begriff ,Letzte Generation‘ gespielt hat, im Sinne von ,Wir sind die Letzten, die an der Situation noch etwas ändern können, bevor das totale Chaos beginnt‘. Fast das gleiche Narrativ hat die rechtsextreme Seite kopiert – offenbar, weil sie gemerkt hat, dass es gut ankommt – allerdings beim Thema Migration: ,Wir sind die letzte Generation, die Migration stoppen kann, bevor die Situation außer Kontrolle gerät.‘ Auch hier können wir ein gegenseitiges Lernen auf beiden Seiten beobachten, ein Framing und eine Kommunikationsstrategie, die sich Rechts von Links abgeschaut hat.“
Wie ist der historische Hintergrund, wenn wir die Dresscodes der Extremistinnen und Extremisten betrachten? Wann hat es angefangen, dass politische Gesinnung über den Kleidungsstil zu erkennen gegeben wurde?
„Einen genauen Zeitpunkt kann ich hier nicht nennen. Aber wenn wir uns die Marke Fred Perry anschauen, sehen wir, dass vor allem die britische Skinhead-Szene irgendwann angefangen hat, diese Brand zu tragen. Ihre Mitglieder haben sich vor allem der Arbeiterbewegung verpflichtet gefühlt. Fred Perry war ein Tennisspieler, der mehrfach Wimbledon gewonnen, aber trotzdem keinen Adelstitel verliehen bekommen hat. Daher hat man als eine Art solidarische Unterstützung angefangen, seine Marke zu tragen. Irgendwann kam die Marke auch in der deutschen Skinhead- und Hooligan-Kultur an, insbesondere der Lorbeerkranz im Logo wurde zu einem zentralen Merkmal.“
Ein ähnliches Schicksal ereilte die Marke LONSDALE …
„Das stimmt, allerdings hat man sich hier ganz klar gegen diese rechtsextreme Vereinbarung positioniert – mit Kampagnen für Demokratie und Vielfalt. Weshalb die Szene ab einem gewissen Zeitpunkt bemerkt hat, dass es nicht mehr so vorteilhaft ist, diese Marke zu tragen. Gleichzeitig haben sich nämlich auch linke Künstlerinnen und Künstler, Bands oder Aktivisten und Aktivistinnen, die sich für Vielfalt einsetzen und eine gewisse Reichweite haben, bewusst in Marken wie LONSDALE oder Fred Perry gezeigt. Alle gemeinsam haben erreicht, dass diese Marken inzwischen weniger von der rechtsextremen Seite getragen werden.“
Fred Perry war jüdisch – allein deshalb ist es schon absurd, dass rechte Skinheads diese Marke tragen, obwohl man in diesem Zusammenhang erwähnen muss, dass die Skinhead-Bewegung originär nicht rechts war und ist. Sie haben eben den Siegerkranz im Logo der Marke erwähnt. In der rechten Szene werden sehr gerne solche Codes genutzt, die dann auch auf der Kleidung abgebildet werden. Ein Beispiel ist die „88“, die für „Heil Hitler“ steht. Welche Codes werden noch über Bekleidung transportiert?
„Ein gutes Beispiel für diese Codes sind die Proud Boys, eine rechtsextreme Organisation in den USA. Ihr Logo und damit ihre Symbolfarben sind Schwarz und Gelb. Es gab mal ein Fred-Perry-Poloshirt in diesen Farben, das die Proud Boys als zentrales Identifikationsmerkmal getragen haben. Dazu gab es dann aber ein offizielles Statement von Fred Perry, die Marke nahm das Shirt-Modell in Kanada und den USA sogar vom Markt, damit es nicht länger instrumentalisiert werden konnte. An diesem Beispiel sieht man sehr gut, dass die Zugehörigkeit zu einer Organisation mit den Farben der Bekleidung wiedergegeben werden kann. In Deutschland kennen wir das mit Schwarz-Weiß-Rot, den Farben der Reichskriegsflagge. Es gibt in der Szene beliebte T-Shirts oder Mützen, die genau diese Farben repräsentieren, um die Nähe zum Deutschen Reich auszudrücken. Ziel und Zweck ist ein gewisses Sender-Empfänger-Prinzip: Ich weiß, dass ich diese Message sende, aber auch andere müssen es wissen, damit meine Nachricht ankommt. Nur so kann ein Identifikationsgefühl entstehen. Darüber hinaus gibt es die von Ihnen erwähnten Codes wie die ,88‘ oder ,14‘ von ,14 Words‘: ,We must secure the existence of our people and a future for white children‘ der amerikanischen White-Pride-Bewegung. Die Zahl 14 ist also auch eine zentrale rechtsextremistische Kennung, die gerne auf T-Shirts oder als Tattoomotiv genutzt wird.Dieses Sender-Empfänger-Prinzip spricht auch gegen die Argumentationslinie mancher, dass man gewisse Kleidungsstücke nicht mehr tragen darf. Wenn ich als Privatperson keine rechtsextreme Ideologie teile und diese mittels meiner Kleidung repräsentativ nach außen zeigen möchte, kann ich mich problemlos in Schwarz-Weiß-Rot kleiden.“
In der TAZ gab es einen sehr spannenden Artikel über einen linken Verein, der sich Markenrechte für solche Codes sichert und sie auf diesem Weg sozusagen zurückerobert. Wie ist hier Ihre Einschätzung?
„Es gibt sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten, sich einen gewissen Raum im politischen Diskurs zurückzuholen. Wir haben gesehen, dass dies bei Marken wie Fred Perry oder LONSDALE gelungen ist. Wenn man das zusätzlich juristisch untermauern möchte, indem man sich Markenrechte sichert, wird es möglich, gegebenenfalls auch juristisch gegen Akteure der rechtsextremen Szene vorgehen zu können. Wie erfolgreich solche Initiativen sind, wird die Zeit zeigen. Es wird vor allem schwierig sein, gegen jedes einzelne kleine Label oder auch Einzelpersonen rechtlich vorzugehen, die diese entsprechenden Codes zum Beispiel auf Bekleidung drucken lassen. Wenn man allerdings große Unternehmen dahingehend einschränken kann, rechtsextreme Codes zu verbreiten, sehe ich diese Maßnahme als eine relativ optimistische Strategie an, Akzente zu setzen.“
Wir sind gespannt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung und den interessanten Austausch!
Der Interview-Partner
Felix Neumann arbeitet seit 2022 bei der Konrad-Adenauer-Stiftung als Referent für Extremismus- und Terrorismusbekämpfung. In dieser Rolle beschäftigt er sich mit allen extremistischen und gewaltbereiten Bestrebungen in Deutschland, Europa und weltweit. Insbesondere konzentriert er sich auf online basierte Ideologien.