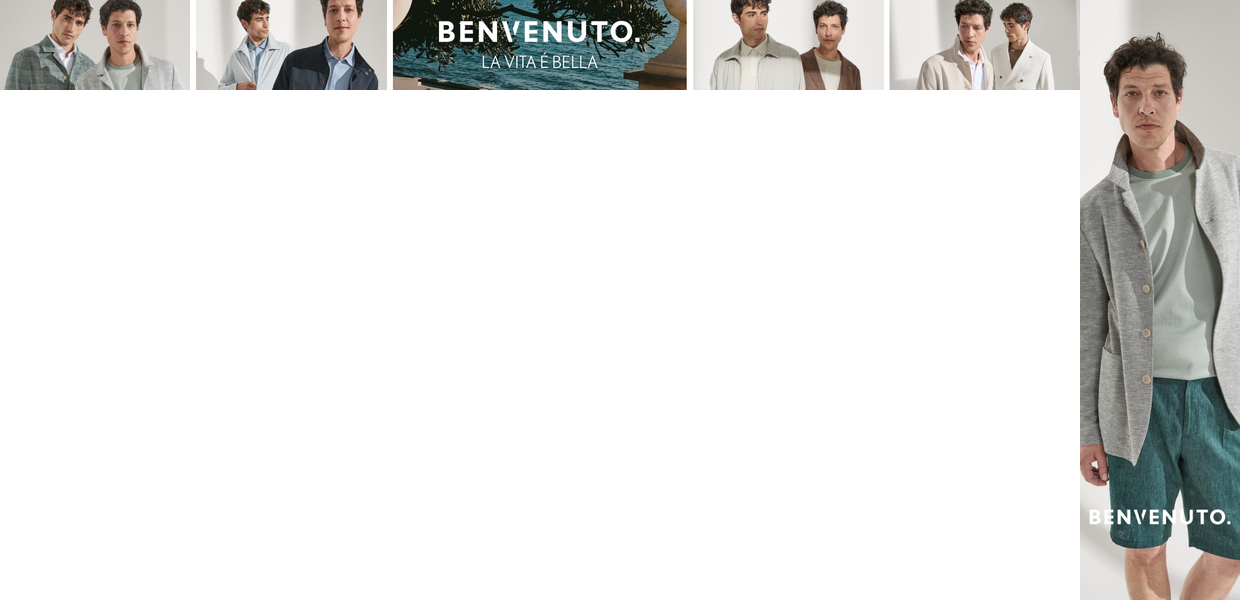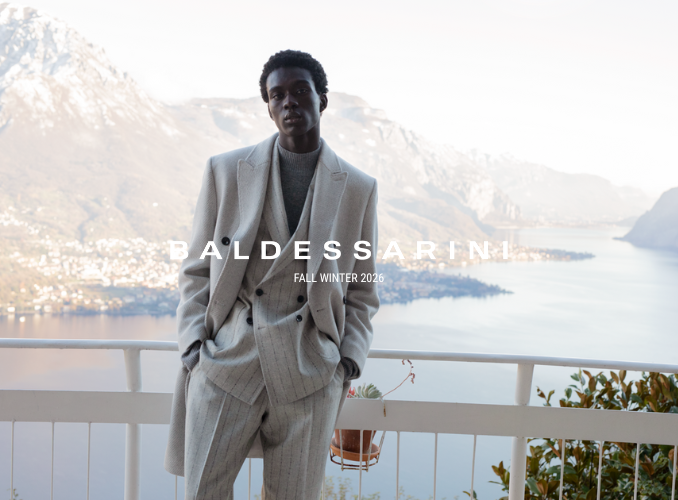Autorin: Eva WesthoffDas Europäische Parlament und der Rat der EU-Staaten haben eine vorläufige Einigung über eine geänderte EU-Abfallrahmenrichtlinie erzielt. Unternehmen werden verpflichtet, sich an den Kosten für die Sammlung, Sortierung und das Recycling von Alttextilien zu beteiligen. In diesem Zusammenhang ist jeder EU-Mitgliedstaat aufgefordert, sein eigenes System der Erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) für Textilien und Schuhe einzurichten. Vorgesehen ist, dass für jedes Produkt eine ökomodellierte, den gesamten Lebenszyklus berücksichtigende Gebühr entrichtet werden muss – und zwar von demjenigen, der das Produkt erstmals gewerbsmäßig unter eigenem Namen oder eigener Marke auf den Markt bringt. In die Pflicht genommen werden also die Hersteller beziehungsweise Inverkehrbringer.
Unter dem Titel „Konzeptpapier des Handels zu Systemen der Erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien und Schuhe in Deutschland“ hat der BTE Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren gemeinsam mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) und der Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels (AVE) eine Stellungnahme zur bevorstehenden Einrichtung eines Systems für Erweiterte Herstellerverantwortung in Deutschland verfasst. Was steht drin? Wir haben mit Gudrun Höck, Referentin beim BTE und Expertin für Umwelt und Nachhaltigkeit, gesprochen.
FASHION TODAY: Frau Höck, was hat den BTE als Handelsverband veranlasst, ein eigenes Konzeptpapier zur EPR zu veröffentlichen?
Gudrun Höck: „Viele der Handelsunternehmen, die wir zusammen mit dem HDE und der AVE vertreten, insbesondere Filialunternehmen, bringen Eigenmarken in Verkehr und sind damit von der EPR betroffen. Oft haben sie im Hinblick auf Kreislaufsysteme schon Erfahrungen gesammelt – mehr noch als der klassische Markenhersteller von Textilien vielleicht. Diese Erfahrungen, beispielsweise in den Bereichen Verpackung oder Elektro- beziehungsweise Batterierücknahme, sollten für den Textil- und Schuhbereich gewinnbringend genutzt werden. Letztlich ist bei der Umsetzung der neuen Richtlinie aber die Zusammenarbeit der gesamten Branche gefragt.“
Der BTE plädiert für die Aufrechterhaltung bereits etablierter Sammel- und Verwertungsstrukturen und für ein privatwirtschaftlich und wettbewerblich organisiertes System. Was stellen Sie sich genau vor?
„Wie ein funktionierendes System aussehen kann, ist noch gemeinsam zu erarbeiten. Klar ist: Ein Monopol möchten wir nicht. Warum sollte man Fehler, die bereits gemacht wurden, wiederholen? Wir hatten den Grünen Punkt, das System hat sich nicht gerechnet und musste noch einmal neu aufgesetzt werden. Der Weg führt über den Wettbewerb. Die Erfahrungen aus den bisher implementierten EPR-Systemen zeigen, dass dies kosteneffizienter ist. Jeder muss sich entscheiden können, wer für ihn der richtige Partner ist. Und es gibt bereits einige, die in den Startlöchern stehen.“
Meinen Sie damit die sogenannten Producer Responsibility Organisations (PROs), die Inverkehrbringer gegen eine Gebühr bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen zum Recycling und zur Abfallbewirtschaftung unterstützen?
„Ja, zum Beispiel. Zudem ist ein zentrales Register sicher sinnvoll. Jeder Inverkehrbringer könnte gesetzlich verpflichtet werden, sich dort registrieren zu lassen – eine Regelung, die es im Rahmen des Verpackungsgesetzes ja bereits gibt. Im zentralen Verpackungsregister werden Mengen und Typen an Verpackungen erfasst und wer sogenannte systembeteiligungspflichtige Verpackungen nutzt, muss sich an den zukünftigen Entsorgungskosten beteiligen. Als Teil eines EPR-Systems für Textilien und Schuhe könnte eine solche zentrale Stelle über die Einnahme von Beiträgen auch Investitionen steuern, etwa in die Entwicklung effizienter Recyclingtechnologien, die die Faserqualität erhalten. Beim hochwertigen Textilrecycling mangelt es ja bislang an Kapazitäten.“
Aktuell werden in Deutschland jährlich etwa eine Million Tonnen Alttextilien gesammelt, eine Sammelquote von über 60 Prozent. Recycelt wird aber nur ein Bruchteil.
„In Deutschland haben wir eine gute Sammelquote und dann kommt für Bekleidung recyceltes Material aus Flaschen zum Einsatz. Macht das Sinn? Die Sammler sehen sich zunehmend mit minderwertigen Qualitäten konfrontiert und können sich mit Secondhand-Verkauf nicht mehr finanzieren. Wenn diese Sammler wegbrechen, ist keinem geholfen. Es muss nicht einfach nur eine Verpflichtung geben, wir brauchen ein System, das die Unternehmen nicht übermäßig belastet und für die ökologischen Aspekte Wirkung zeigt – und nicht einfach nur ein bürokratisches Monster ist. Dafür setzen wir uns als BTE ein und das ist auch der Auftrag, den wir von unseren Mitgliedern haben. Wenn es sinnvoller ist, ein Produkt in Putzlappen zu reißen, auch weil es sich anders nicht rechnet, dann sollen es bitte Putzlappen werden. Wenn Wiederverwendung oder Faser-zu-Faser-Recycling umsetzbar ist, dann bitte so. Heute ist für die Sortierung noch viel Handarbeit erforderlich. Mit der Gebühr, die im Rahmen der Erweiterten Herstellerverantwortung zu entrichten ist, könnte beispielsweise auch die maschinelle Erkennung von Qualitäten, Farben, Materialien vorangetrieben werden.“
Die Gebühr, die die Inverkehrbringer entrichten sollen, ist als ökomodellierte Gebühr gedacht. Wie kann diese berechnet werden? In seinem Konzeptpapier mahnt der BTE klare Definitionen und Kriterien für künftige ökologische Bewertungen an, etwa mit Blick auf Haltbarkeit, Recyclingfähigkeit und Reparierbarkeit. Kann hier der Digitale Produktpass (DPP) weiterhelfen, als Teil der neuen, im vergangenen Jahr formal in Kraft getretenen EU-Ökodesign-Verordnung (ESPR)? Sie betonen, dass Rechtssicherheit unter anderem nur dann gewährleistet ist, wenn man sich im Rahmen der Ökodesign-Verordnung bewegt.
„Ökomodulation, das hört sich gut an. Aber die Frage der Berechnung ist noch ungeklärt. Fest steht: Der Nachweis darf nicht zu kompliziert sein, sonst wird es zu teuer. Es muss praktikabel bleiben. Wir können jetzt nicht damit anfangen, individuell auf jedes einzelne Produkt zu schauen. In Bezug auf den Digitalen Produktpass, der kommen soll, ist ja auch noch vieles unklar. Wir müssen jedenfalls gucken, dass wir uns nicht verzetteln. Dass nachher nicht irgendetwas ausgefüllt werden muss pro Kleidungsstück und dann eventuell in jedem EU-Land für das gleiche Produkt noch einmal andere Anforderungen gelten. Pragmatische Lösungen sind gefragt.“
„Die Ultra-Fast-Fashion-Plattformen müssen auf jeden Fall in das EPR-System miteinbezogen werden und es muss sichergestellt werden, dass sie sich im Rahmen der EU-Gesetze bewegen, wenn sie ihre Waren in Verkehr bringen. Hier muss die Marktüberwachung, die Kontrolle der Behörden funktionieren, auch durch eine Verstärkung der Zollkontrollen.“
Im Konzeptpapier wird eine Staffelung der Regelung vorgeschlagen, bei der zunächst „Massenprodukte“ mit einer ökomodellierten Gebühr belegt werden.
„Wenige Produktgruppen machen schätzungsweise 80 Prozent des Marktes aus. Mit diesen Produktgruppen sollte man beginnen. Denn wenn ich die Seidenbluse mit Langlebigkeitskriterien und so weiter belege, ist das ökologisch kaum relevant. Nehmen wir Jeans und T-Shirts: Wie viele verschiedene Materialien gibt es allein hier, wie viele Mischgewebe? Und auch diese Mischgewebe haben ja ihre Berechtigung, im Sport- oder Outdoor-Bereich zum Beispiel. Da kommen Sie allein mit Baumwolle nicht weiter. Und ist Baumwolle wirklich ökologischer, wenn man den Wasserverbrauch berücksichtigt? Wenn der Recyclinganteil in einem T-Shirt verpflichtend auf 30 Prozent festgesetzt wird, dies aber zulasten der Langlebigkeit geht, weil sich die Fasern verkürzen – macht das dann Sinn? Es gibt so viele verschiedene Aspekte, das Thema Ökomodulation ist sehr komplex. Und es stellt sich eben auch die Frage: Wie soll man die Einhaltung von Kriterien kontrollieren? Wenn noch ein Extralabel für recycelbar oder für Langlebigkeit eingefordert wird, dann erhöht das natürlich nicht nur den organisatorischen Aufwand, sondern auch den Preis eines Produkts. Um Doppelzertifizierungen und Extrakosten zu vermeiden, sollten deshalb anerkannte unabhängige Nachhaltigkeitssiegel akzeptiert werden. Wir wollen ja etwas erreichen mit dem System, für die Umwelt. Und wir haben auch viele minderwertige Qualitäten auf dem Markt, zu großen Anteilen durch plattformgestützte Drittstaatenanbieter, die unkontrolliert direkt zum Kunden versenden, ohne die gesetzlichen Regelungen zu beachten. Es müssen für alle Marktteilnehmer gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten.“
Auch deshalb sprechen Sie sich in Ihrem Konzeptpapier für eine starke Marktüberwachung und für Sanktionen aus.
„Die Ultra-Fast-Fashion-Plattformen müssen auf jeden Fall in das EPR-System miteinbezogen werden und es muss sichergestellt werden, dass sie sich im Rahmen der EU-Gesetze bewegen, wenn sie ihre Waren in Verkehr bringen. Hier muss die Marktüberwachung, die Kontrolle der Behörden funktionieren, auch durch eine Verstärkung der Zollkontrollen. Und bei Verstößen müssen schnelle Sanktionen folgen beziehungsweise kurzfristig Maßnahmen ergriffen werden, die nicht gesetzeskonformes Verhalten unmittelbar unterbinden – nicht erst in irgendwelchen Verfahren Monate später, wenn die Verantwortlichen bereits auf andere Plattformen ausgewichen sind. Es dürfen nicht die Marktteilnehmer bestraft werden, die kontrolliert werden und großen Aufwand betreiben, die gesetzlichen Regelungen einzuhalten. Das Ganze ist ein Riesenthema, das politisch angegangen werden muss.“
Fürchten Sie eine gesetzliche Verpflichtung, Rückgabestellen im Handel einzurichten?
„Eine Verpflichtung für den Handel zu sammeln sollte es auf keinen Fall geben. Nicht jeder Händler hat Platz in seinem Geschäft. Und dann stellt sich ja auch die Frage: Ab wann ist ein Artikel Abfall? Da ist man dann auf einmal mittendrin im Abfallrecht und muss damit umgehen. Wenn ein großer Händler eine Rücknahmestelle einrichten möchte, weil er sich dadurch vielleicht mehr Frequenz verspricht, warum nicht? Einige große Händler praktizieren das ja bereits. Aber bitte keine Pflicht. Jede Räumlichkeit, jede Situation, jedes Geschäft ist anders. Wir haben in Deutschland gute Sammelstrukturen, auf die man aufbauen kann.“