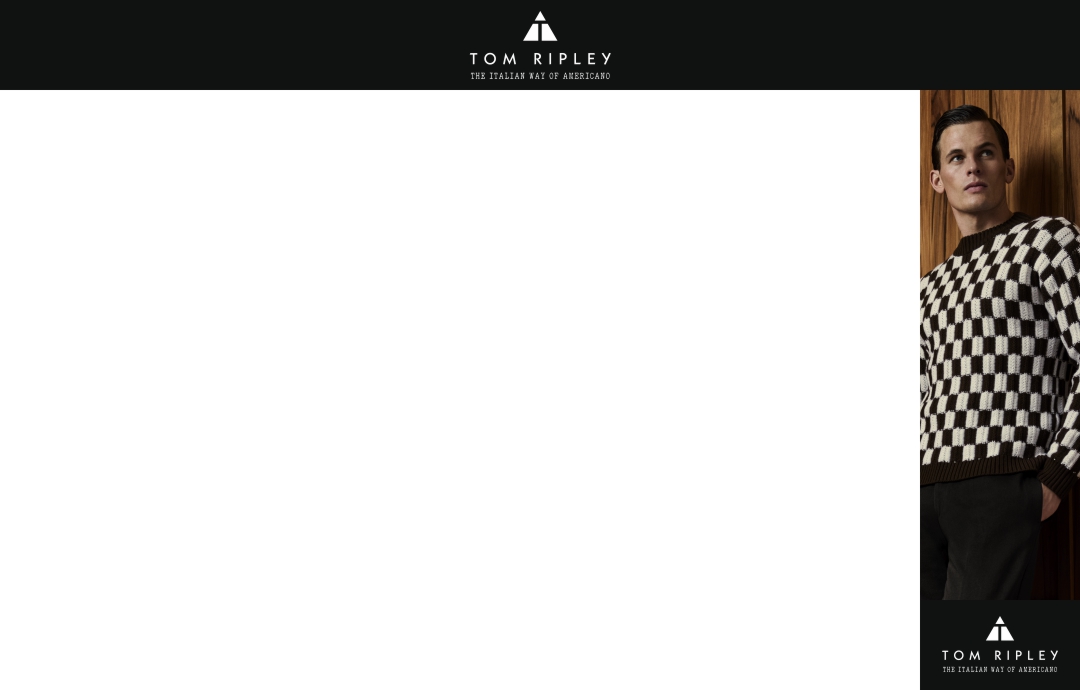Autor: Markus OessItaliens Modehandel kämpft mit Umsatzrückgang und Geschäftsaufgaben – Verbände fordern politische Unterstützung. Gleichzeitig steht die Branche vor einem Strukturwandel. Die regionalen strukturellen Unterschiede im Land machen die Lage dabei nicht eben einfacher. Eine Bestandsaufnahme.
Nach einem schwierigen Jahr 2024 steht der italienische Modeeinzelhandel vor strukturellen Herausforderungen. Während große Ketten wachsen und touristische Regionen profitieren, verlieren viele unabhängige Händler an Boden. Der Branchenverband Federazione Moda Italia – Confcommercio warnt vor einer drohenden Verödung der Innenstädte – und fordert steuerliche Entlastungen, faire Wettbewerbsbedingungen und Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des stationären Handels.
Der italienische Modeeinzelhandel ist heterogen aufgebaut – und massiv unter Druck. 2024 sank der Umsatz durchschnittlich um 4,2 Prozent, wie der Verband mitteilt. Der Saldo aus Eröffnungen und Schließungen fiel mit einem Minus von 6.459 Verkaufsstellen deutlich negativ aus. Die Zahl täglicher Geschäftsaufgaben liegt bei 18, in den vergangenen 5 Jahren waren es im Schnitt 13 pro Tag. Damit gingen rund 23.000 Läden und mehr als 35.000 Arbeitsplätze verloren. Und auch die Konsumdaten geben Anlass zur Sorge: Die Winterschlussverkäufe 2025 verzeichneten ein Minus von 5,5 Prozent, 60 Prozent der befragten Unternehmen meldeten rückläufige Umsätze.

Die Struktur des Marktes liegt in einem Spannungsfeld zwischen traditionellen Fachgeschäften und wachstumsstarken Filialkonzepten. Rund 78 Prozent der Modeunternehmen bestehen laut Businesscoot aus Mikro- und Kleinbetrieben – vielfach inhabergeführt, lokal verwurzelt und stark auf Stammkunden angewiesen. Daneben wachsen Monobrand-Ketten wie PINKO oder Doppelgänger sowie Filialunternehmen der „Grande Distribuzione Organizzata“ (GDO) wie OVS, DECATHLON oder PRIMADONNA. Letztere erzielen Jahresumsätze im dreistelligen Millionenbereich und profitieren von zentraler Steuerung und Omnichannel-Strukturen. Im Bereich zwischen beiden Polen operieren Verbundgruppen der „Distribuzione Organizzata“ (DO) – Einkaufskooperationen kleiner Händler, die in anderen Warengruppen (Lebensmittel) etabliert sind und zunehmend auch Mode führen.
Eine Sonderstellung nehmen die Warenhäuser ein. Allen voran LA RINASCENTE, das mit neun Standorten und einem Jahresumsatz von rund 1 Milliarde Euro (2023) als einziges italienisches Warenhaus im Premiumsegment Maßstäbe setzt. Der Flaggschiff-Store am Mailänder Dom trägt rund die Hälfte des Umsatzes. Das Sortiment kombiniert Luxusmarken mit Interior, Kosmetik und Gourmetangeboten. Mit einem ähnlichen Konzept, aber kleinerer Reichweite agiert BRIAN&BARRY, ebenfalls in Mailand ansässig. Im mittleren Preissegment positionieren sich coin (inklusive coin EXCELSIOR) mit etwa 40 Häusern sowie upim mit über 300 Standorten (einschließlich Franchise). Diese Formate verbinden Mode, Haushalt und Lifestyle zu einem breit angelegten Einkaufsangebot. In der Fläche spielen sie eine stabilisierende Rolle, vor allem in Mittel- und Süditalien.
Die strukturellen Probleme bleiben

Auch regional zeigen sich deutliche Unterschiede. Norditalien ist geprägt von einer hohen Dichte an Ketten, Flagship Stores und Outlets. Städte wie Mailand, Turin oder Bologna sind sowohl Sitz großer Marken als auch attraktive Standorte für internationale Formate. In Mittelitalien, etwa in Rom oder Florenz, trifft touristische Nachfrage auf ein gemischtes Angebot aus Traditionshäusern, Boutiquen und Warenhäusern. In Süditalien dominieren kleinere Läden, häufig familiengeführt, und DO-Strukturen. Impulse kamen hier zuletzt durch die Absenkung der Schwelle für steuerfreies Einkaufen auf 70 Euro: In Städten wie Catania oder Neapel stiegen die Umsätze um mehr als 60 Prozent.
Doch die strukturellen Probleme bleiben. „Unser grundsätzlich positiver Geist wird durch aggressive Verkaufspolitiken unserer Lieferanten untergraben“, sagt Verbandspräsident Giulio Felloni. Gemeint sind Hersteller, die über Online-Kanäle, Outlets und interne Verkaufsaktionen abseits des Fachhandels agieren. „Diese folgen nicht dem Prinzip ‚gleicher Markt, gleiche Regeln‘“, so Felloni. Der Verband fordert deshalb ein ethisches Lieferkettenabkommen, steuerliche Vergünstigungen für nachhaltige Mode, eine reduzierte Mehrwertsteuer sowie staatliche Anreize zur Modernisierung und Nachnutzung leer stehender Flächen. Die Zukunft des italienischen Modeeinzelhandels entscheidet sich damit entlang zweier Linien: Anpassung an verändertes Konsumverhalten auf der einen, politische und strukturelle Unterstützung für den stationären Handel auf der anderen. Andernfalls droht vielen kleinen Händlern der Rückzug – mit langfristigen Folgen für Arbeitsplätze, Innenstadtlagen und die Produktion made in Italy.