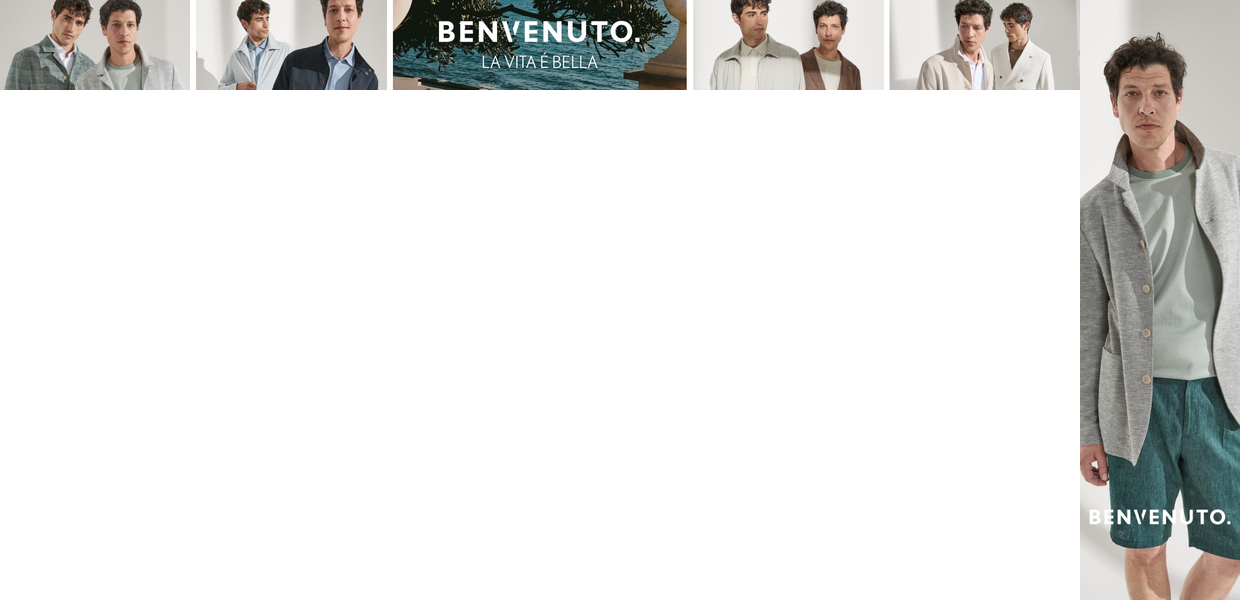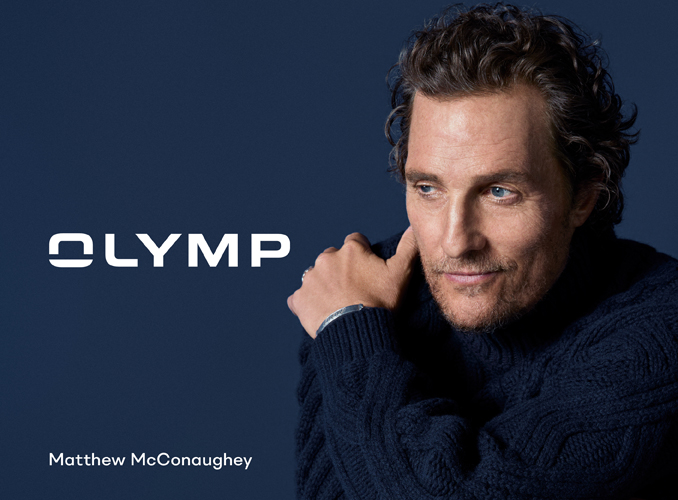Autorin: Katja VadersBereits im Juni 2024 legte der EU-Rat erste Eckpunkte der EPR-Richtlinie zur erweiterten Herstellerverantwortung fest. Im Fokus stehen Zielvorgaben für Abfallvermeidung, Sammlung sowie für Wiederverwendung und Recycling von Textilien bis Ende 2028, um zur Minimierung von Textilabfällen beizutragen und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Seit dem 1. Januar 2025 ist die Getrenntsammlung von Textilabfällen in Deutschland nun auch verpflichtend. Wie sehen die deutschen Hersteller die EPR-Richtlinien und vor allem ihre Umsetzbarkeit? FASHION TODAY fragte Thomas Lange, CEO GermanFashion Modeverband Deutschland e.V., nach seiner Einschätzung.
FASHION TODAY: Herr Lange, wie sehen Sie die EPR-Richtlinie und glauben Sie, dass sie tatsächlich die Reduktion von Abfällen, die Förderung der Kreislaufwirtschaft sowie eine Gestaltung von nachhaltigeren Produkten begünstigt?
Thomas Lange: „Ja, das können wir tatsächlich annehmen. Die EPR-Richtlinie ist ein wichtiger Mosaikstein im Rahmen der vielen Gesetze und Verordnungen, die in Kraft getreten sind oder auf dem Weg dahin die Nachhaltigkeit in der textilen Kette gewährleisten.
Allerdings ist der Weg zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft noch steinig, denn es gilt, die Gestaltung des Systems national und fair umzusetzen. Hier spielen die Gebühren, die Unternehmen zahlen, eine entscheidende Rolle, genauso wie die sogenannte ,Ökomodulation‘ – also quasi eine Belohnung, wenn sich zum Beispiel Unternehmen mit ihren Produkten nachhaltiger aufstellen als andere.“
Wie schätzen Sie die Umsetzbarkeit der EPR-Richtlinie ein? Welchen Herausforderungen müssen sich Unternehmen in diesem Zusammenhang stellen?
„Eine erste Herausforderung ist es sicherlich, dieses System in Deutschland und Europa zu etablieren. Für Bekleidung ist es nun einmal komplett neu, auch wenn wir von anderen Produkten wie Batterien oder Verpackungen durchaus lernen können. Ein anderes Problem ist der Flickenteppich der unterschiedlichen Lösungen, der sich bereits andeutet. Für deutsche Unternehmen, die ihre Bekleidung in ganz Europa auf den Markt bringen, wird es kompliziert, sollten wir voneinander abweichende Lösungen in Sachen Gebühren, Dokumentations- und Registrierungspflichten und so weiter in den verschiedenen Ländern vorfinden. Das wäre dann die nächste bürokratische Hürde. Das Ganze gerecht und fair aufzubauen, ist last, but not least sicherlich eine weitere große Herausforderung. Da muss man sich die Frage stellen: Was zahlt etwa ein kleines, nachhaltiges Unternehmen für ein hochwertiges T-Shirt, das designt wurde, um lange zu halten, und was ein Fast-Fashion-Riese, dessen Produkte kaum den Sommer überstehen?“
Welche Kosten kommen in diesem Zusammenhang auf die Bekleidungshersteller zu? Und was bedeutet das längerfristig, vor allem für die Fast-Fashion-Industrie?
„Hier ist das wichtige Stichwort der Ökomodulation zu nennen, welches bereits im Rahmen der Ökodesign-Verordnung eine wichtige Rolle spielt. Letztendlich müssen diejenigen Hersteller finanziell belohnt werden, die nachhaltige und langlebige Bekleidung herstellen. Nur so kommen wir langfristig weg von Fast Fashion.“
Werden die Maßnahmen infolge der neuen Richtlinien Ihrer Ansicht nach tatsächlich zu einer nachhaltigeren Textilindustrie führen? Oder sehen Sie auch jetzt schon Probleme?
„Die EPR-Richtlinie steht für erweiterte Herstellerverantwortung und genauso ist sie auch zu verstehen. Die deutschen Bekleidungsunternehmen sind bereits seit einiger Zeit auf dem Weg, ihre Lieferkette nachhaltig und ,sauber‘ aufzustellen. Alle Verordnungen, Richtlinien und Gesetze im Rahmen des Green Deals sind darauf ausgerichtet, die Bekleidungsbranche langfristig noch nachhaltiger zu machen.“
Die EPR-Richtlinie zielt darauf ab, Forschung und Entwicklung innovativer Technologien für die Kreislaufwirtschaft im Textilsektor zu fördern. Zudem möchte man illegale Exporte von Textilabfällen in Entwicklungs- und Schwellenländer verhindern. Sind das hehre Wünsche oder sehen Sie diese Ziele als realistisch an?
„Das erste Ziel ist sehr realistisch, denn wir sprechen hier nicht von Wünschen, sondern von Pflichten, die Unternehmen im Rahmen von diversen Gesetzen einfach zu leisten haben. Die Gebühren, die bei der Wertstoffverarbeitung zu erbringen sind, sind dazu bestimmt, in Technologie investiert zu werden.
Exporte von Bekleidung etwa nach Afrika ‒ darauf spielen Sie wahrscheinlich an ‒ unterliegen einem eigenen Gesetz, und zwar der Abfallverbringungsverordnung. Das Problem liegt hier tatsächlich in der Fast Fashion und den mangelhaften Qualitäten. Die Kleidung wird von den Aufkäufern in Kilogramm abgerechnet und enthält heute deutlich mehr Bekleidungsteile, die nicht mehr weiter nutzbar sind. Und diese landen dann auf den bekannten großen Müllbergen.“
Was wird sich durch die Richtlinie für die Verbraucher verändern? Wird Bekleidung mittelfristig teurer werden? Und was bedeutet die Umsetzung der Recyclingmaßnahmen für uns alle im Alltag?
„Wie sich die Abverkaufspreise entwickeln, kann man heute nicht sagen, es spielen diesbezüglich ja noch viel mehr Dinge eine Rolle. Die Unternehmen haben jedoch in den letzten Jahren viel in Nachhaltigkeit und auch IT investiert, ohne dass die Preise gestiegen sind. Auch mit Blick auf die anderen europäischen Länder, die bereits mit der Umsetzung angefangen haben, bestätigt sich diese Annahme.
Dem Verbraucher mitzugeben, dass Bekleidung eben kein ,Müll‘ ist, den man nach (kurzer) Benutzung wegschmeißt, sondern ihn als wichtigen Wertstoff begreift, ist aus unserer Sicht ein wichtiges Unterfangen und sollte in der Kommunikation eine Rolle spielen. Unsere Branche bietet viel in Sachen nachhaltige Bekleidung … es ist wünschenswert, wenn auch der Konsument durch sein Einkaufsverhalten an diesem Strang mitzieht.“
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Lange!
Der Interviewpartner
Thomas Lange arbeitet bereits seit 30 Jahren für den GermanFashion Modeverband Deutschland e.V. Zunächst war er Rechtsreferent in der Beratung der Mitgliedsunternehmen, später als Geschäftsführer im Bereich Berufs- und Schutzkleidung tätig. Seit dem Jahr 2018 ist Thomas Lange CEO des Verbandes.