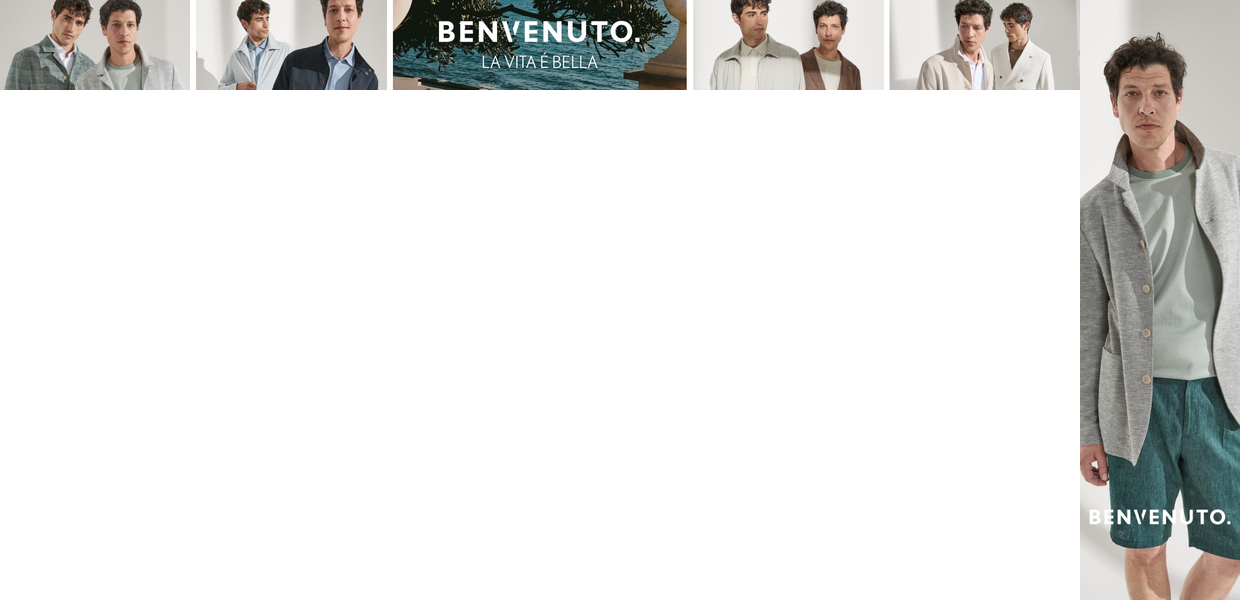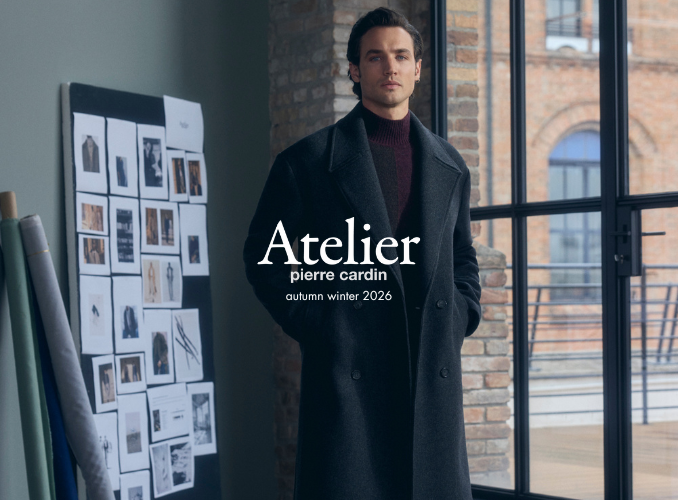Autorin: Eva WesthoffEine Schlagzeile von Anfang November: Mitarbeiter einer Bananenplantage in Costa Rica haben sich erfolgreich gegen schlechte Arbeitsbedingungen gewehrt. Die Grundlage bot ihnen das Lieferkettengesetz. Nach einer Beschwerde und etwa zweijähriger Verhandlungszeit haben sie nun Entschädigungszahlungen erhalten, wie die Entwicklungsorganisation OXFAM mitteilte. An den Verhandlungen war neben OXFAM, einer lokalen Gewerkschaft, einem Zulieferer und einem Bananenproduzenten der Discounter ALDI SÜD beteiligt, bei dem die Beschwerde nach dem Lieferkettengesetz – genauer: dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) – unter anderem eingereicht worden war. Zum ersten Mal wurden als Konsequenz aus einer solchen Beschwerde Zahlungen an Betroffene geleistet. ALDI habe konstruktiv gemeinsam mit Gewerkschaft, Zulieferer und Produzent nach Lösungen gesucht, heißt es seitens OXFAM.
Das Lieferkettengesetz, es greift. Natürlich, Bananen sind keine Produkte mit langen, komplexen, oft undurchsichtigen Lieferketten. Doch auch über den konkreten Kontext hinaus gibt es ein wichtiges Learning. „Das Ergebnis zeigt, dass das Lieferkettengesetz wirkt, denn es stärkt ganz konkret die Rechte von Betroffenen. Der Prozess im Beschwerdefall hat offenbart, dass es essenziell ist, Gewerkschaften und Unternehmen an einen Tisch zu bringen“, äußert sich Tim Zahn, OXFAM-Referent für Menschenrechte in globalen Lieferketten.
Eine jüngere, weniger erfreuliche Nachricht vom 13. November: Das EU-Parlament hat das sogenannte Omnibus-I-Paket durchgewunken. Neben Anpassungen der CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zur Nachhaltigkeitsberichterstattung umfasst es unter anderem Änderungen bezüglich der EU-Lieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, kurz: CSDDD). Federführend: die Europäische Volkspartei (EVP), die größte Fraktion im EU-Parlament. Diese war sich nicht zu schade, das Verhandlungsmandat mithilfe von Kräften vom rechten Rand zu beschließen. Teil der EVP, die den Zusammenschluss von christlich-demokratischen und konservativen Parteien in Europa darstellt, sind auch CDU und CSU.
Es war der zweite Versuch. Bereits zur ersten Abstimmung hatte es vor einigen Wochen ein unwürdiges Vorspiel gegeben. Nicht nur die Initiative Lieferkettengesetz, ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus Menschenrechts-, Entwicklungs- und Umweltorganisationen, Gewerkschaften und Kirchen, monierte„Erpressungsversuche“ auf Kosten von Menschenrechten und Klima. Jörgen Warborn, EVP-Berichterstatter, so der Vorwurf, soll schon damals damit gedroht haben, sich die Zustimmung zu einer abgeschwächten Version der ursprünglich vorgesehenen EU-Lieferkettenrichtlinie notfalls mithilfe von rechts außen zu sichern. Dass im Oktober eine knappe Mehrheit der Abgeordneten gegen den Kompromiss zur Abschwächung des Gesetzes stimmte, obwohl dieser durch die EVP, die Sozialdemokraten (S&D) und die Liberalen zuvor ausgehandelt worden war – dass es angesichts der bekannten Mehrheitsverhältnisse in der geheimen Abstimmung also Abweichler in den eigenen Reihen gegeben haben muss, hatte die erneute Abstimmung überraschend nötig gemacht. „Anstatt Verantwortung zu übernehmen, hat die EVP die Richtlinie so kompromisslos ausgehöhlt, dass selbst Parteien der demokratischen Mitte und die Von-der-Leyen-Koalition nicht mehr zustimmen konnten. Dieses Ergebnis ist nicht Ausdruck fehlender Einigkeit – es ist die Konsequenz der Erpressungstaktik der EVP“, hatte Heike Drillisch von der Initiative Lieferkettengesetz die gescheiterte erste Abstimmung kommentiert.
Nun wurde eine deutliche Abschwächung des Gesetzes tatsächlich durchgeboxt und nebenbei die Brandmauer eingerissen. Die Änderung sieht vor, dass die Sorgfaltspflichten nur noch für Großunternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro gelten, statt den ursprünglich anvisierten 1.000 Mitarbeitenden und einer Umsatzgrenze von 450 Millionen Euro. Hinzu kommt unter anderem der Verzicht auf eine EU-weite Regelung zur zivilrechtlichen Haftung bei Verstößen. Auch soll es nicht verpflichtend sein, Klimapläne auszuarbeiten. „Die heutige Entscheidung im Europaparlament ist ein totaler Rückschritt für Europa und für die Werte von Europa“, so VAUDE-Geschäftsführerin Dr. Antje von Dewitz gegenüber dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft BNW. „Es bedeutet eine verpasste Chance für Menschenrechte, für Umweltschutz und für fairen Wettbewerb. Für nachhaltige Unternehmen ist es total klar, dass wir verbindliche Rahmenbedingungen brauchen.“ Von einer enttäuschenden und zerstörerischen „Zementierung des Rechtspakts“ sprach der Vorsitzende der Europa-SPD René Repasi.
Transformation nicht durch Populismus verstolpern
Worum geht es der EVP eigentlich, warum agiert sie ohne Rücksicht auf Verluste? Und worum ging es der FDP, als sie sich Anfang 2024 gegen die deutsche Zustimmung zum EU-Lieferkettengesetz stellte, welches dann bekanntlich doch noch, trotz deutscher Enthaltung, vom EU-Parlament angenommen wurde? Was bezweckt Friedrich Merz, wenn er als Kanzler der Bundesrepublik die Abschaffung des Lieferkettengesetzes fordert – so geschehen im Frühjahr in Brüssel?
International anerkannte Menschenrechte sind nicht verhandelbar, ebenso wenig verbindliche Umweltstandards. Vielmehr sollten wichtige Debatten um das Wie weniger polarisierend geführt und nicht für Partei- und Klientelpolitik missbraucht werden. Weder im europäischen Kontext noch auf Bundesebene. Bis das europäische Lieferkettengesetz im Juni 2028 zur Umsetzung gelangt – ein Jahr später als zunächst vorgesehen –, greift in Deutschland ja weiter das deutsche Lieferkettengesetz LkSG. Auch dieses in bereits abgeschwächter Form: Vor dem Hintergrund der im Koalitionsvertrag vereinbarten „Entbürokratisierung“ wurde im September mit einem Beschluss des Bundeskabinetts ein Gesetzentwurf für ein geändertes LkSG auf den Weg gebracht, unter anderem mit ersatzlos und rückwirkend gestrichener Berichtspflicht.
Bürokratieabbau, das ist es, was Wirtschaftsverbände fordern. Das Lieferkettengesetz galt in seiner ursprünglichen Form als „Bürokratiemonster“. Doch die Verwässerung der Lieferketten-Gesetzgebung trifft ebenso auf Widerstand, auch abseits von Interessenverbänden und NGOs: Über 250 Wirtschaftswissenschaftler aus ganz Europa wandten sich zuletzt in einer gemeinsamen Erklärung gegen eine Abschwächung der EU-Nachhaltigkeitsvorschriften im Rahmen des Omnibus-I-Pakets. Nachhaltigkeit sei keine regulatorische Belastung, sondern ein strategischer Vorteil, der die Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft Europas stärke, heißt es hier. Die Wissenschaftler warnen davor, sich kurzsichtigen populistischen Narrativen anzuschließen, die Nachhaltigkeitsvorschriften ausschließlich als Kostentreiber darstellen. Es fehle eine fundierte evidenzbasierte Analyse.
„CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)-konforme Lieferketten bieten Unternehmen einen tieferen Einblick in ihre Wertschöpfung, stärken ihre Position gegenüber Investoren und Konsumenten und werden so zu einem echten Wettbewerbsvorteil“, äußerte sich auch René Petri von Proxima, Teil der Strategieberatung BAIN & COMPANY, in einem Interview gegenüber FASHION TODAY. Tatsächlich haben sich seit Inkrafttreten des LkSG 2023 etliche Unternehmen entschlossen, Transparenz und Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Sie haben in Software investiert und Strukturen geschaffen, um ihren Nachweispflichten nachzukommen. Die politischen Streitigkeiten könnten auch ihnen zum Nachteil gereichen.
Schutz vor Kinderarbeit, Sklaverei und Zwangsarbeit, ein garantierter Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umweltregeln? Ja, das ist nötig. Transformation muss stattfinden. Wollen wir wirklich etwas ändern, brauchen wir überprüfbare Standards und zeitnahe Sanktionen. Die Entscheidung des EU-Parlaments und wie sie zustande kam, stimmt mehr als nachdenklich.